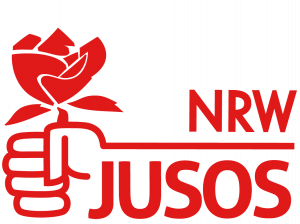Wir fordern, dass sich alle demokratischen Parteien in Deutschland um einen Kohleausstieg bemühen, der mit dem 1,5-Grad-Ziel und damit mit dem unterzeichneten Pariser Klimaschutzabkommen kompatibel ist. Als NRW Jusos stellen wir dabei nicht nur Ausstiegsforderungen, sondern haben 2019 mit dem Beschluss „Mensch, Struktur, Wandel: Unser Weg zum sozialistischen und ökologischen Umbau der Wirtschaft“ auch Vorschläge unterbreitet, wie ein guter Transformationsprozess aussehen kann:
Die Energieversorgung der Zukunft ist weder fossil noch atomar. Wir wollen den Ausstieg aus Kohle und Atom. Die Frage nach dem Datum des Kohleausstiegs ist dabei sowohl in der Gesellschaft als auch in unserem Verband hoch umstritten. Der Kompromiss der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (Kohle-Kommission), der schrittweise Ausstieg aus der Förderung von Braunkohle und Verstromung von Braun- und Steinkohle bis zum Zeitkorridor 2035 bis 2038 ist mutlos, ideenlos und das Ergebnis eines mangelnden Investitionswillens und kapitalistischer Unternehmensinteressen. Auf Seiten der Beschäftigten vor Ort und anderer lokaler Akteur*innen herrscht große Unsicherheit, denn am Ruhrgebiet wird deutlich, welche Folgen ein gescheiterter Strukturwandel hat. Doch aufgrund der breiten Beteiligung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteur*innen in der Kommission – Arbeitgeber*innen, Industrie, Gewerkschaften, Politik, die Kirchen, Umweltverbände und Bürger*innen aus den betroffenen Revieren – kann der Kompromiss nicht einfach beiseite gewischt werden. Wir müssen alles dafür tun, dass die Energiewende sozial und schnell geschieht. Dazu müssen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden:
- Ein wirklich tragfähiges Konzept für die betroffenen Regionen zur Umstrukturierung der Wirtschaft. Wir können uns keinen weiteren gescheiterten Strukturwandel leisten. Eine Deindustrialisierung muss dabei verhindert werden.
- Die Demokratisierung der Wirtschaft: Solange kapitalistische Interessen Vorrang vor dem Gemeinwohl haben, kann es keine nachhaltige, soziale und ökologische Transformation geben.
- Massive Investitionen in den Umbau der Energieversorgung und Infrastruktur. Die Kosten müssen von denen getragen werden, die viel haben und geben können. Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen und ohne nennenswerte Vermögen müssen entlastet werden.
Wenn diese Bedingungen nicht nur politische Lippenbekenntnisse sind, sondern mit konkreten Plänen und Maßnahmen unterlegt werden, dann unterstützen wir einen schnelleren Kohleausstieg bis 2030.
Deutschland ist der größte Kohlenstoffdioxidemittent in Europa, weltweit der sechstgrößte. Im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft – und darüber hinaus – sollte die Bundesrepublik daher als Vorreiter in Sachen Klimaschutz agieren. Der diskutierte “European Green Deal” ist dabei ein Schritt in die richtige Richtung, bedarf aber weiterer Überarbeitung und des Drucks der Öffentlichkeit.
In vielen Bereichen, nicht nur im Energiesektor, müssen deutlich höhere Anstrengungen unternommen werden, um den Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel leisten zu können, der zu Recht von Deutschland verlangt werden darf. Ein wichtiger Baustein ist dabei ein früherer Kohleausstieg.
Das Kohleausstiegsgesetz hingegen ist das Ergebnis einer zu wenig ehrgeizigen Energiewende. Es legt den Kohleausstieg auf allerfrühestens 2035, möglicherweise sogar erst 2038 fest. Dies hätte neben Millionen Tonnen zusätzlichen CO2-Ausstoßes zur Folge, dass in den Abbaugebieten noch sieben weitere Dörfer umgesiedelt und abgebaggert werden.
Dabei muss erwähnt werden, dass im letzten Jahr ohne staatliche Subventionen schon 90% der Kohlekraftwerke Verlust gemacht hätten, da Kohlekraft in Deutschland insgesamt nicht mehr profitabel ist. Im Hinblick darauf erscheint es umso unverständlicher, dass Konzerne mit Milliardensummen für unrentable Kraftwerke abgefunden werden. Hier wird eine Branche und eine Energieform gesponsert, die die Energiewende bremst und heute und in Zukunft weltweit für Umwelt- und Klimaschäden verantwortlich ist.
Für uns ist klar, dass wir nicht die Großkonzerne unterstützen müssen. Das Augenmerk muss vielmehr auf den Arbeitnehmer*innen und den vom Strukturwandel betroffenen Regionen liegen, die zur Erhaltung ihrer wirtschaftlichen Lebensgrundlage zurecht Solidarität und massive Investitionen von Seiten des deutschen Staates verlangen dürfen. Zudem ist klar, dass die Energiekonzerne sich in den Bergbauregionen nicht aus der Verantwortung ziehen dürfen. Auf Jahrzehnte hinaus werden Investitionen etwa in Fragen der Renaturierung der Tagebaue nötig sein.
Die Bewirtschaftung der Kohlekraftwerke bis 2038 ist nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar, sozial ungerecht und belastet insbesondere den globalen Süden – während Energiekonzerne in Deutschland Steuergelder in Milliardenhöhe erhalten.
Die Kohlekommission darf nicht die Argumentationsgrundlage liefern, dass wir uns vom 1,5-Grad-Ziel verabschieden. Auch wenn mit ihr der Versuch unternommen wurde, einen gesamtgesellschaftlichen Kompromiss zu erzielen und unterschiedliche Gruppen an einen Tisch zu holen, ist hervorzuheben, dass insbesondere die Interesseren der jungen Menschen nicht vertreten wurden. Auch die Perspektiven, Bedürfnisse und Meinungen derjenigen, die mittelbar und unmittelbar von den Schäden an Umwelt und Klima betroffen sind, wurden nicht ausreichend gehört. Diese Position sollte nicht gegen heimische Arbeitsplätze (in der Kohleverstromung – von denen im Bereich der Erneuerbaren Energien ist in dieser Diskussion leider selten die Rede) ausgespielt werden.
Viele Klimawissenschaftler*innen positionieren sich gegen das Kohleausstiegsgesetz und legen Studien vor, nach der auch ein früherer und ehrgeiziger Kohleausstieg möglich und nötig ist. Dabei wird Deutschland mit einem früheren Ausstieg der Verantwortung gerecht und überschreitet nicht sein CO2-Budget von 6,7 Gigatonnen CO2. Eine Erwärmung von 2°C können und dürfen wir uns nicht leisten. Wir dürfen nicht eine Kettenreaktion von Kippelementen im Klimasystem in Kauf nehmen! Für eine volkswirtschaftlich verträgliche und mit den internationalen Klimaschutzzielen kompatible Minderung der Treibhausgasemissionen können wir uns keinen verspäteten Kohleausstieg leisten.
Ein ökologischer Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis 2030 ist möglich und kann in Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen, Klimaaktivist*innen, betroffenen Regionen und Arbeitnehmer*innen sozialverträglich gestaltet werden.
Glück auf!
Quellen:
https://www.scientists4future.org/defizite-kohleausstiegsgesetz-kvbg-e/
http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-518419.html
https://www.wissenschaft.de/umwelt-natur/wie-viele-arbeitsplaetze-kostet-der-ausstieg/