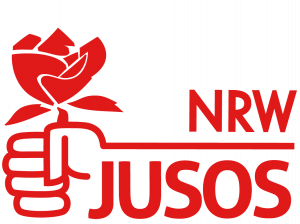1. Einleitung
Anspruch jungsozialistischer Politik ist es, dass jeder Mensch das Leben führen kann, was er*sie führen möchte. Zur Erfüllung dieses Anspruchs ist Bildung nicht alles, aber ohne Bildung ist alles nichts. Sie ist der zentrale Schlüssel dafür, dass die persönliche Zukunft nicht länger von der eigenen Herkunft abhängt. Damit das endlich Realität wird, brauchen wir ein Bildungssystem, das allen Menschen die Möglichkeit bietet, sie selbst zu werden, sich zu verwirklichen und eben das Leben zu führen, das sie führen möchten. Wir brauchen ein Bildungssystem, das ganz unterschiedliche Lebenswege ermöglicht und sie nicht länger verhindert. Kurzum: Wir brauchen ein anderes Bildungssystem als das jetzige. Wir brauchen einen Neustart Bildung.
Als Jungsozialist*innen wissen wir, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ins Leben starten und wir wollen es nicht länger hinnehmen, dass sich diese unterschiedlichen Voraussetzungen auch in unterschiedliche Verwirklichungschancen übersetzen. Die Verantwortung, diese strukturelle Bildungsungleichheit auszugleichen, darf aus unserer Sicht nicht länger auf die individuelle Ebene delegiert werden. Besonders Neoliberale schmücken sich dabei gern mit dem Begriff der Chancengleichheit und meinen damit eigentlich, dass jede*r es schaffen kann, wenn man sich nur genug anstrengt. Dieser Politik der Besitzstandswahrung für all diejenigen, die eh schon mit den besten Voraussetzungen auf die Welt kommen, wollen wir eine aktive Bildungspolitik entgegensetzen, die nicht nur von Chancengleichheit redet, sondern proaktiv Bildungsarmut bekämpft. Denn Bildung sorgt für Teilhabe, auf die alle Menschen ein Recht haben und deshalb müssen wir endlich Schluss machen mit einem Bildungssystem, das systematisch nach vier Schuljahren entscheidet, wer welche Teilhaberechte bekommt. Wir müssen Schluss machen mit einem Bildungssystem, das Selektions- und Diskriminierungsmechanismen anwendet, die mit einer demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar sind. Auch dafür braucht es einen Neustart Bildung und wie dieser aussehen muss, dazu stellt der vorliegende Antrag weitreichende Forderungen.
2. Gerechte Schule
Der Weg zu einer gerechteren Schule ist lang, jedoch erreichbar. Wir wollen und müssen diesen Weg beschreiten, damit Schüler*innen die Möglichkeiten im Schulsystem bekommen, die ihnen zustehen. Wir wollen ein gerechteres Schulsystem – in dem Schüler*innen selbstbestimmt lernen, welches frei von einer Schulstruktur ist, in der Schüler*innen kategorisch und diskriminierend ausdifferenziert werden. Wir wollen hin zu einem Schulsystem, das innovativ konzeptioniert ist und in dem Lernkonzepte bedarfsgerecht ausgelegt sind – und in dem keine Chancenungerechtigkeiten reproduziert werden. Die Schule muss ein innovativer Ort mit innovativen Lernkonzepten werden. In Deutschland gehört die soziale Herkunft innerhalb des Schulsystems immer noch zu einem der ausschlaggebendsten Faktoren für Bildungschancen. Das zeigen uns vor allem Ländervergleichsstudien, aus denen klar zu entnehmen ist, was in diesem Schulsystem falsch läuft und welche verrosteten Hebel wir schleunigst entrosten und betätigen müssen. Bereits die erste PISA Studie aus dem Jahr 2000 hat den hohen Modifizierungsbedarf des Schulsystems deutlich gemacht – und Jahre später können wir sagen, es hat sich einiges getan, aber wirklich innovativ und gerechter ist die Schule nicht geworden. Wir können vor allem davon ausgehen, dass sich in Zeiten der Pandemie Missstände innerhalb des Schulsystems verhärtet haben – was uns vor einen akuten Handlungsbedarf stellt. Für uns ist klar, so wie die Schule gerade läuft kann sie nicht bleiben.
(Eine gerechtere) Schulstruktur
Wenn wir von einer Schule für alle sprechen, dann meinen wir damit ein umfassendes Konzept, das nicht nur regelt, dass alle Kinder zusammen lernen, sondern alle damit einhergehenden Rahmenbedingungen. Ein wesentlicher Rahmen ist die Schulstruktur, die ein gemeinsames Lernen und die Förderung aller Schüler*innen ermöglichen muss.
Hierzu gehört beispielsweise, dass alle Schüler*innen von der ersten Klasse bis zum jeweiligen Abschluss an einem einzigen und wohnortnahen Standort unterrichtet werden. Von der ersten bis zur sechsten Klasse muss es am gleichen Standort einen baulich getrennten Schutzraum geben. Grundsätzlich soll es innerhalb kleiner Klassen binnendifferenzierten Unterricht geben, der ausreichend Rückzugsräume bietet. Dies ist aber nur mit ausreichend Personal und multiprofessionellen Teams möglich. Diese umfassen Lehrkräfte, Sozialpädagog*innen und die Assistenzen der Schüler*innen mit Förderbedarf. Auf einer Schule für alle soll es auch alle Formen der Schulabschlüsse geben. Nach der zehnten Klasse kann dann in die Oberstufe für die Hochschulreife gewechselt werden. Wichtig ist hier, dass die Oberstufe ein offenes Konzept bleibt, auch für diejenigen, die das Abitur zu einem späteren Zeitpunkt nachholen wollen oder noch nicht die formalen Vorgaben dafür erfüllen. Dafür benötigt es zum einen ein Qualifizierungsprogramm in Form einer Zwischenstufe. Zum anderen muss es flexible (Teilzeit-) Angebote für diejenigen geben, die die Oberstufe neben dem Beruf oder Careaufgaben besuchen.
Die eine Schule für alle muss selbstverständlich inklusiv sein. Für gelingende Inklusion ist eine Aufstockung von Personal unabdingbar, damit multiprofessionelle Teams wirklich funktionieren und nicht Sozialpädagog*innen die Aufgaben der Assistenzen übernehmen, wie es aktuell häufig im Schulalltag der Fall ist. Außerdem ist zu prüfen, wie ein Verzicht auf das Labeln der Förderschwerpunkte möglich sein kann, sodass diese erst mal vollständig anonymisiert sind und das Team für alle Kinder da ist. Hier kann sich am Beispiel der Laborschule orientiert werden. Grundsätzlich gilt es die jetzige Einteilung der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte zu verändern, da sie aktuell zu einem vorschnellen Labeln und damit zur Abstufung von Schüler*innen führt.
Diese von uns geforderte Schulform funktioniert nur, wenn sie mit einer bestimmten Haltung einhergeht, die vor allem durch die Lehrer*innenschaft, aber auch vom ganzen System verkörpert werden muss, damit auch Schüler*innen damit aufwachsen und sie verinnerlichen. Diese umfasst den Umgang miteinander auf Augenhöhe und einen ganzheitlichen Bildungsansatz, der sich auf Kompetenzen konzentriert und nicht auf die Betonung von Defiziten aus ist. Mit- und Selbstbestimmung von Schüler*innen muss die Basis sein.
Schule mit den richtigen Lerninhalten
Wenn wir Schule neu denken, stellt sich nicht nur die Frage, wie wir die systemischen Rahmenbedingungen der schulischen Bildung gestalten wollen – sondern auch was für uns eigentlich schulische Bildung beinhalten soll. Dass die bisherigen Lerninhalte einer grundlegenden Reform bedürfen, bestätigen nicht nur unsere persönlichen Erfahrungen als junge Menschen oder unsere Gespräche mit Lehrenden, sondern auch bekannte Bildungsforscher*innen, wie etwa Klaus Hurrelmann: Der Unterricht geht an den Lebensrealitäten der Kinder und Jugendlichen vorbei.
Schon aus Gründen der für eine gerechtere Schule notwendigen systemischen Reformen, die dazu führen, dass Schulfächer, wie wir sie kennen, möglicherweise in einer Schule von morgen nicht mehr existieren, schreiben wir keine Curricula. Wir formulieren stattdessen unsere Maßstäbe und Ansprüche an die Lerninhalte für eine gute Bildung.
Für eine gute Bildung braucht es Lerninhalte, die Antworten auf die Probleme der Schüler*innen liefern. Demokratische Bildung, Medienkompetenz, Selbstreflexion und Selbstständigkeit müssen im Mittelpunkt eines zukünftigen Lernkonzeptes stehen. Wir wollen, dass die schulische Grundbildung die für das selbstständige Leben als mündige Bürger*innen notwendige Wissen, vor allem aber die notwendigen Fähigkeiten vermittelt. Schule verstehen wir als Ort, um junge Menschen zu mündigen Bürger*innen in einer Demokratie zu erziehen. Daher steht für uns nicht im Vordergrund, wie es oft von Neoliberalen gefordert wird, dass Schule dazu dient, auf das kapitalistische Wirtschaften vorzubereiten. Auch, wenn es wichtig ist, Grundkenntnisse für das Arbeitsleben zu vermitteln, liegt unser Fokus darauf, junge Menschen auf das Leben vorzubereiten und nicht nur auf die Arbeit.
Gesellschaftswissenschaften müssen deshalb, genauso wie Naturwissenschaften, einen größeren Stellenwert einnehmen. Insbesondere die größten gesellschaftlichen Herausforderungen kommender Generationen rund um die vielfältige Gesellschaft, Klima- und Umweltschutz und Digitalisierung sind Richtschnur für die auf die Bewältigung dieser Herausforderungen ausgerichteten Lerninhalte.
Wo Lerninhalte hinzukommen, müssen andere zurückgefahren werden. Für uns besteht insbesondere bei den bisherigen sogenannten „Hauptfächern“ Mathe, Deutsch und Englisch ein erheblicher Reformbedarf. Moderne Literatur anstelle unreflektierter Analysen alter Bücher und die Lösung lebensnaher Probleme statt theoretischer Kurvendiskussionen sind Beispiele dafür. Wo konkret gekürzt werden kann und muss, sollen Bildungsexpert*innen entscheiden: Schüler*innen, Forschende und sozialpädagogische Fachkräfte.
Schule ohne Noten
Die Schule braucht neue Konzepte der Leistungsbeurteilung – das „Notensystem“ ist veraltet und nicht mehr zeitgemäß und entspricht schon gar nicht unserem Verständnis und unserer Vision einer innovativen und gerechteren Schule. Ganz im Gegenteil: das „Notensystem“ trägt zu einem großen Teil dazu bei, dass Leistungsbeurteilungen nicht gerecht verteilt werden, die Miteinbeziehung der Individuallage von Schüler*innen findet hier keinen Raum. Für einen erfolgreichen Kompetenzerwerb der Lehrinhalte sehen wir es als unabdingbar, die Individuallage von Schüler*innen miteinzubeziehen. Das jetzige „pädagogische Notensystem“ tut dies allerdings nicht – es basiert auf einem homogenen Beurteilungssystem, welches eine bedarfsgerechte und individuelle Leistungsbeurteilung nicht zulässt. Vielmehr verschärft es die Chancenungerechtigkeit innerhalb des Schulsystems und versetzt Schüler*innen und Lehrkräfte in hierarchische Positionen – wodurch eine Begegnung auf Augenhöhe kaum möglich ist. So belegen Studien, dass das Wissen über die Milieuzugehörigkeit von Schüler*innen die Beurteilung durch Lehrende beeinflusst. Vergleichbare Leistungen von Schüler*innen aus bildungsferneren Milieus werden zum Teil schlechter bewertet, Schulempfehlungen nach der vierten Klasse fallen schlechter aus. Die Auswirkungen des pädagogischen Leistungsverständnisses können somit eine demotivierende Wirkung auf Schüler*innen haben – was bedeutet, dass schlechte Noten sie nicht fördern, sondern innerhalb ihres schulischen Entwicklungsprozesses einschränken. Wir brauchen also ein Beurteilungssystem, welches die individuelle Lebenslage von Schüler*innen berücksichtigt und eine fördernde Lernkultur schafft. Leistungsbewertung durch Lehrer*innen kann nie objektiv sein, aber es gilt ein System zu entwickeln, das den Einfluss von beispielsweise Herkunft auf die Beurteilung durch Lehrende miniminiert. Dafür fordern wir vor allem, dass Schüler*innen an Leistungsbewertungsprozessen partizipieren dürfen und diese in dialogischen und fördernden „Bewertungsräumen“ erfolgen. Ebenso sprechen wir uns gegen Hausaufgaben aus, da auch diese Hürden in den Weg legen. Diese werden in den privaten Raum verlegt und somit ungleiche Bedingungen reproduziert.
Schule als Lern- und Lebensort
Unsere Schule für alle soll mehr als nur ein Ort sein, an dem Lerninhalte von Lehrkräften an Schüler*innen vermittelt werden. Vielmehr begreifen wir sie als einen Lern- und Lebensort, der Schüler*innen in ihrem Alltag begleitet und ihnen auch außerhalb des Unterrichts die bestmögliche Unterstützung bietet.
Im Ganztagsbereich sollen die Kinder und Jugendlichen deshalb nicht nur einfach über den Nachmittag verwahrt werden. Die Arbeitsgemeinschaften (AGen) vermitteln den Schüler*innen außerhalb des Lernstoffes Schlüsselkompetenzen. Sie sollen Schüler*innen animieren, ihre Umgebung aktiv und kritisch wahrzunehmen. Dafür muss ihnen ein breites Programm aus naturwissenschaftlichen, aber auch sozialwissenschaftlichen Fachbereichen und der Linguistik geboten werden. Auch Musik, Theater und Sport können Teil dieser AGen sein. Bei der Konzeptionierung der AG-Programme sollen Schüler*innen eng eingebunden werden, ebenso bei ihrer Evaluation. Lokale Initiativen und Vereine sind für viele Angebote sinnvolle Kooperationspartner*innen und tragen zur lokalen gesellschaftlichen Anbindung der Schüler*innen bei.
Im Ganztagsbereich fehlt es aktuell noch an flexiblen Angeboten. Wir wollen, dass gerade hier die Schüler*innen den notwendigen Raum finden, um sich frei entfalten. Nicht immer im institutionalisierten Bereich der AGen, sondern auch unter Anleitung selbstorganisiert mit ihren Mitschüler*innen. Und selbstverständlich braucht es außerhalb dieses Rahmens auch einfach Rückzugsmöglichkeiten für Schüler*innen, damit ihnen die Schule als Lebensort auch nach der Lernzeit Aufenthaltsqualität bietet.
Ein weiterer Baustein der Schule als Lern- und Lebensort ist eine Ausfinanzierung der Schulsozialarbeit. Noch heute sind ihre Beratungs- und Betreuungsangebote an den Schulen vielen unbekannt. Oft wissen Schüler*innen auch nicht, wofür die Schulsozialarbeiter*innen überhaupt zuständig sind. Um sie mit ihren Angeboten auch wirklich erreichen und unterstützen zu können, braucht es verpflichtende Betreuungsschlüssel und eine Personaloffensive in der Schulsozialarbeit.
Dabei sollen die Schulsozialarbeiter*innen in allen Lebenslagen vertrauensvolle Ansprechpartner*innen außerhalb des Lehrkörpers für alle Schüler*innen sein. Im Lebensort Schule geben sie auch bei Problemen Hilfestellung, die außerhalb der Schulzeit, im Privaten, beispielsweise in der Familie liegen. Dafür steht der präventive Charakter ihrer Arbeit. Diese Arbeit muss aber auch entsprechend wertgeschätzt werden. Sozialarbeiter*innen sind keine billigen Betreuungskräfte, sondern gleichberechtigter Teil des Kollegiums einer Schule. Das muss sich auch in der Bezahlung und in der Entfristung ihrer Verträge niederschlagen. In unserer Schule für Alle gibt es keine Schulsozialarbeiter*innen mehr, die sich über die Sommerferien arbeitslos melden müssen, um dann zum Beginn des neuen Schuljahres neu eingestellt zu werden.
Gute Entlohnung und Entfristung umfasst für uns auch, dass alle Lehrkräfte selbstverständlich in jeder Stufe gleiche Arbeit leisten und daher auch gleiche Bezahlung verdienen. Ebenso muss auch hier verhindert werden, dass Lehrer*innen für die Sommerferien arbeitslos werden.
3. Digitalisierung
Eine weitere gesellschaftliche Herausforderung, der die Schule von morgen begegnen muss, ist die Digitalisierung. Sie kommt einer industriellen und gesellschaftlichen Revolution gleich: Sie verändert Kommunikation, Arbeitsweise und letztlich Potenziale unserer Gesellschaft.
Bis 2030 wird der Anteil der Arbeit, der technisches Wissen voraussetzt, um bis zu 55% steigen, während immer weniger händische oder motorische Fertigkeiten benötigt werden (minus 14%)[1].
Die Kernelemente einer gelungenen digitalen Bildung in der Schule haben wir bereits formuliert: Es braucht Investitionen in digitale Infrastruktur, Entwicklung und Bereitstellung guter digitaler Lernsoftware und Lerninhalte sowie ein umfangreiches Aus- und Fortbildungsprogramm. Die Verantwortung für die Etablierung dieser wesentlichen Rahmenbedingungen darf das Land nicht auf die Kommunen abwälzen – um Bildungsgerechtigkeit herzustellen muss es diesen Herausforderungen selbst begegnen.
Digitale Infrastruktur meint die Ausstattung der Schüler*innen mit Endgeräten, die ausreichende Anbindung von Schulen an das Internet und die Herstellung der notwendigen Server- und Supportkapazitäten an den Schulen.
Gute digitale Lernsoftware und Lerninhalte meint, dass funktionierende und auf die Bedürfnisse der an Schule beteiligten Akteur*innen abgestimmte Software entwickelt und Lerninhalte konzeptioniert werden, die – genau wie andere Lerninhalte auch – nicht an den Lebensrealitäten der Schüler*innen vorbei stattfinden. Sie muss Lernende mit den Mitteln und Methoden von heute auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten.
Die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften ist essenziell für gelungene digitale Bildung: Nur wenn Lehrkräfte selbst digitale Kompetenzen sowie die notwendigen medienpädagogischen Fähigkeiten erworben haben, können sie diese an Schüler*innen vermitteln. Der aktuelle Stand ist ein anderer. Das muss von der Landesregierung als Dienstherrin anerkannt und die notwendigen Maßnahmen getroffen werden.
4. Diversität an Schulen
Auch Schulen spiegeln nicht unsere vielfältige Gesellschaft. Immer noch haben nicht alle Kinder- und Jugendliche die gleichen Chancen. Das Lehrpersonal ist nicht divers und Schule ist kein „diskriminierungsfreier“ Raum. In Lehrinhalten sind Lebensrealitäten meist weiß, cis, heteronormativ und männlich. Nicht-diversitätssensible Schulen führen zu Ungleichheiten, reproduzieren Diskriminierungen und lehren nicht Realität.
Diversität und Chancengerechtigkeit – Forderungen
Wenn es um den Diversitätsdiskurs im Bildungskontext geht, wird dieser oftmals losgekoppelt von reproduzierten Ungerechtigkeitsdimensionen, welche innerhalb von Bildungsinstitutionen entstehen, betrachtet. Was bedeutet, dass der Diversitätsdiskurs nun auch endlich in bildungspolitischen Räumen angekommen ist, wir aber weitgehender denken müssen. Dahingehende Diskurse und politische Lösungsansätze dürfen nicht in performativen Projekten, wie „Schule ohne Rassismus“ oder „Schule mit Courage“ enden. Natürlich bilden diese Projekte relevante Sensibilisierungsimpulse, allerdings geht mit ihnen die Gefahr einher, dass Bildungsinstitutionen darüber hinaus nicht die Möglichkeit geboten wird, strukturell und personell etwas zu verändern. Lösungsansätze müssen so orientiert sein, dass Diversitätssensibilität und mögliche Ansätze ein fester Bestandteil der Schulstruktur und des Lernens werden – anders können sie als mögliche Reproduktionsstätten sozialer Ungerechtigkeiten keine Diversitätskompetenzen erlangen und „diskriminierungsfreie“ Räume werden.
Diversität umfasst unterschiedliche Lebensrealitäten und Ungerechtigkeitsdimensionen. Es geht im Bildungskontext vor allem um marginalisierte Kinder und Jugendliche, die von Ableismus, Klassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit und Rassismus betroffen sind. Unser politisches Ziel muss es sein, den Diversitätsdiskurs und daraus resultierende Handlungsoptionen dahin lenken, dass Bildungsinstitutionen inklusive Orte werden, an denen sich betroffene Kinder- und Jugendliche diskriminierungsfrei aufhalten können und ihnen Hilfestrukturen bereitstehen. Um das zu erreichen, muss sich sowohl strukturell als auch didaktisch etwas ändern.
Diskriminierungsfreie Bildungsstrukturen schaffen
Für die Entgegenwirkung der aufgeführten Diskriminierungsdimensionen bedarf es eines strukturellen diversitätsbewussten Wandels.
Diesen strukturellen Wandel sehen wir zum einen innerhalb der Organisationsebene und zum anderen innerhalb des Beziehungsverhältnisses der Kinder, Jugendlichen und des Lehrpersonals. Damit zweiteres erfolgen kann, muss das Lehrpersonal mitwirkend an einem diversitätssensiblen Bildungsklima arbeiten. Wir fordern daher, dass innerhalb der Organisationsebene kontinuierliche und reflexive Diversitätssensibilisierungsangebote zum Standard werden. Nicht nur während der Tätigkeit als Lehrperson – oder Erzieher*in – auch schon im Ausbildungsprozessen sollen diese eine verpflichtende Rolle spielen. Zusätzlich müssen sich auch nicht betroffene Schüler*innen mit den Realitäten betroffener Kinder- und Jugendlicher auseinandersetzen. Dies geht mit der Forderung einher, dass Diversitätssensibilität und dessen Vermittlung eine Einbindung in die Vermittlung von Lerninhalten finden soll. Lernmethodische Konzepte sollen somit zukünftig Diversitätsaspekte beinhalten und darauf ausgelegt sein, Diversität als Bildungsauftrag zu vermitteln. Zudem fordern wir für Betroffene bedarfsgerechte Empowermentstrukturen, die durch externe Akteur*innen begleitet werden.
Antidiskriminierungsstellen als Schutzstellen
Gerade für Kinder und Jugendliche gibt es in Bildungsinstitutionen bei aufkommenden Diskriminierungsfällen nur geringe Möglichkeiten der Beschwerde und Beratung – sie sind in den meisten Fällen auf sich allein gestellt und müssen mit den Folgen ihrer traumatischen Erlebnisse allein zurechtkommen – das muss sich ändern. Wir fordern eine Antidiskriminierungsstelle innerhalb von Bildungseinrichtungen, an die sich Kinder, Jugendliche und Eltern bei Diskriminierungsvorfällen melden und beraten lassen können. Auch diese Stelle muss von externen Akteur*innen besetzt werden.
Didaktische Ebene – Lehrplan
Auch die Lehrinhalte an Schulen sind nicht diversitätssensibel, sondern sind stark von einem eurozentristischen, männlichen und heteronormativen Blick geprägt.
Thema Migration
Fast jede*r Vierte hat in Deutschland eine Migrationsgeschichte, dennoch wird das Thema Migration in Schulen kaum oder nur problemorientiert behandelt. Deutschland als Einwanderungsland wird nicht systematisch als Unterrichtsfeld behandelt, so eine Studie des Mercator Forums Migration und Demokratie und des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden. Zum Beispiel die Geschichte der Gastarbeiter*innen, die Zuwanderung von Spätaussiedler*innen und der Fachkräftezuzug sind kaum Thema im Unterricht. Das Thema Migration wird meist in Verbindung mit Krisen und Problemen behandelt, wie Krieg, Vertreibung, Integrationsunwilligkeit oder Identitätsbildung, aber nicht als gesellschaftliche Normalität.
Expert*innen empfehlen deswegen, Migration, Vielfalt und Integration in die Lehrpläne aufzunehmen.
Rassismus und Antisemitismus
Die Themen Rassismus und Antisemitismus müssen auch als eigenständige Themen behandelt werden und nicht nur in Verbindung mit dem Nationalsozialismus. Rassismus und Antisemitismus existieren vor und nach dem Nationalsozialismus, zu oft werden sie aber auf den Nationalsozialismus begrenzt.
Auch der Blick auf den Kolonialismus ist sehr eurozentristisch. „Der Platz an der Sonne“ wird teilweise sogar romantisiert und oft der Eindruck erweckt, als hätte es vor der Kolonialisierung nichts auf dem afrikanischen Kontinent gegeben. Außerdem finden sich im Schulunterricht kaum post- und neokoloniale Perspektiven wieder.
Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
In Rahmen der Lehr- und Bildungspläne, sowie der bundeslandspezifischen Schulgesetze und der Richtlinien zur Sexualaufklärung taucht immer häufiger auch das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auf. Aber es ist noch zu wenig, nicht als Querschnitt und zu oft hängt es von einzelnen Lehrkräften ab, ob und in welchem Ausmaß sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert wird. Grundsätzlich ist die Norm in Lehrmaterialien hetero und cis. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt muss auch im Querschnitt repräsentiert werden.
Feminismus
Frauen sind keine Minderheit, aber sind in Lehrinhalten stark unterrepräsentiert. Es wird immer noch hauptsächlich Literatur von (weißen cis) Männern gelesen. Gendergerechte Sprache ist noch nicht an allen Schulen Normalität. Und auch im Sexualunterricht wird wenig bis gar nicht auf weibliche Lust eingegangen oder Themen wie Abtreibung, Menstruation und Verhütungsmittel werden aus einer männlichen Perspektive behandelt.
Das muss sich ändern, damit Schule so divers ist wie ihre Schüler*innen.
5. Mehr Demokratie in Kita und Schule
Das Bildungssystem hat aus jungsozialistischer Perspektive einen umfassenden Auftrag. Dass es nicht in erster Linie darum gehen darf, Menschen fit für den Arbeitsmarkt zu machen, sondern sie zu befähigen, ihr Leben nach ihren Interessen und Bedürfnissen zu gestalten, haben wir in den vorherigen Kapiteln umfassend erläutert. Es muss also auch darum gehen, pädagogische Konzepte auf Selbst- und Mitbestimmung auszurichten, um schon kleinste Kinder zur Mündigkeit und zur Reflexion zu befähigen. Wer von klein auf lernt, dass die eigene Perspektive für alle wichtig ist und Gehör findet, kann sich auch später politisch einbringen und Gesellschaft mitgestalten. Das geht aber nur, wenn Kindern und jungen Menschen auf Augenhöhe begegnet wird.
Selbst- und Mitbestimmung in der Kita
Die Kitalandschaft in Nordrhein-Westfalen ist auf Grund unterschiedlicher Träger sehr vielfältig. Sowohl die Bildungsvereinbarung, die Bildungsgrundsätze des Landes und das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) regeln in NRW, wie die pädagogischen Konzepte in frühkindlichen Bildungseinrichtungen aussehen sollen. Zwar werden dort zahlreiche Aspekte der Partizipation aufgegriffen und im KiBiz auch betont, dass Kinder „vom pädagogischen Personal bei allen sie betreffenden Angelegenheiten alters- und entwicklungsgerecht zu beteiligen“ sind. Es stellt sich aber die Frage, inwiefern dies auch flächendeckend umgesetzt und entsprechend durch Kontrollinstanzen nachgehalten wird. Es gibt Hinweise darauf, dass dies je nach Träger, Personalkapazitäten und vermutlich auch Standort der Kita (sozialökonomische Struktur des Viertels und bspw. Ressourcen der Eltern, sich einzubringen) stark variiert.
Wir fordern deshalb die verbindliche Einsetzung von Partizipationselementen in frühkindlichen Bildungseinrichtungen. Dies kann beispielsweise ein Kinderparlament mit einem repräsentativen Anteil der Kinder oder auch eine Kinderversammlung mit allen Kindern der Einrichtung sein. Außerdem müssen die Vorgaben für pädagogische Konzepte dahingehend erweitert werden, eine bestimmte Anzahl an projektbezogener Beteiligung im Jahr mit den Kindern durchzuführen, wenn es zum Beispiel um (räumliche) Veränderung innerhalb der Einrichtung oder die Auswahl eines Ausflugsortes geht.
Mitbestimmungselemente müssen darüber hinaus kontinuierlich in den Kita-Alltag eingebunden werden. Das betrifft die Spielgestaltung, Gruppenregeln, aber auch die Interaktion mit Erzieher*innen, wenn es um Aushandlungen und individuelle Bedürfnisse einzelner Kinder geht. Das Abgeben von Macht und die Einhaltung von Grenzen der Kinder durch Erzieher*innen ist für ein selbstbestimmtes Aufwachsen von Kindern unerlässlich. Dabei geht es explizit nicht darum, Kinder sich selbst zu überlassen, sondern ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und als Erzieher*in nach wie vor verantwortungsbewusst zu handeln.
Nicht alle Formen der Mitbestimmung sind für jedes Kind. Wenn beispielweise Sprachbarrieren vorerst verhindern, die eigenen Wünsche und Vorstellungen im Gruppengefüge auszudrücken, ist eine partizipative Beziehungsgestaltung mit Erzieher*innen umso wichtiger. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass wirklich jedes Kind gesehen wird.
Demokratische Schule
Schule muss ein Ort werden, an dem wir Demokratie lernen und leben! Vergleichsweise können wir sagen, dass es im Schulsektor mehr demokratiepädagogische Instrumente und Einsatzmöglichkeiten gibt als im frühkindlichen Bildungsbereich. Aber auch hier zeigt uns der Status quo, dass wir zum einen keinen flächendeckenden Einsatz solcher Formen und Instrumente finden und dass uns zum anderen auch eine Verbindlichkeit der möglichen Einsatzformen fehlt. Demokratie lernen soll im Schulkontext nicht nur bedeuten, dass man Funktionsweisen von demokratischen Systemen im typischen Gesellschaftslehreunterricht „abfrühstückt“ – vielmehr sollen demokratiepädagogische Ansätze als Mittel des Kompetenzerwerbs, der Selbstwirksamkeitsförderung, der partizipationsorientierten Solidaritätsentwicklung und der Stärkung eines Diversitätsbewusstseins innerhalb unserer Gesellschaft dienen.
Best Practice Beispiele zeigen, dass es schon teilhabeorientierte und repräsentative Instrumente, wie zum Beispiel die Schüler*innenvertretung, gibt – oder auch Modellprojekte wie „Demokratie leben“ in den Schulalltag inkludiert werden – allerdings hängt die Aktivierung dieser Instrumente und Projekte oftmals von Ressourcen und Kapazitäten der Schulen und des Lehrpersonals ab. Auch hier variiert der Einsatz derartiger Instrumente je nach Schulstandort und dessen Sozialstruktur. Diese Beobachtung und Realität haben die Folge, dass sich Ungerechtigkeiten durch nicht wahrgenommene Chancen des Einsatzes von demokratiepädagogischen Instrumenten, verschärfen. Denn gerade für den Abbau von existierenden Ungerechtigkeiten und für die Sensibilisierung dieser bilden demokratiepädagogische Instrumente eine wichtige „Hilfestellung“. Schüler*innen an prekären Schulstandorten sollen das Recht auf eine selbstwirksamkeits- und partizipationsfördernde Schule als demokratischen Lernort haben.
Gleichzeitig muss die Gestaltung der demokratischen Schulstruktur gewährleistet werden. Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2018, bei der Lehrkräfte zum einen über den Stellenwert der Demokratiebildung in ihrem Schulalltag und zum anderen über die Einbettung von demokratiepädagogischen Weiterbildungsangeboten in ihrem Studium und Referendariat befragt wurden, spielen sowohl Demokratiebildungsaspekte, also auch Weiterbildungsangebote keine fundamentale Rolle – auch das muss sich ändern.
Wir verknüpfen Demokratiepädagogik mit der Verwirklichung einer solidarischen Gesellschaft, in der jeder Mensch sich selbst verwirklichen kann und seine Teilhaberechte kennt und anwenden kann – in jedem Kontext, in dem er sich befindet. Für uns ist es umso wichtiger, dass diese demokratischen Werte und Rechte bereits früh vermittelt und gelebt werden. Wir fordern daher, dass demokratiepädagogische Ansätze und Instrumente ein fester Bestandteil im Kita- und Schulalltag werden – und das vor allem flächendeckend. Zusätzlich müssen Lehrkräften verpflichtende Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung angeboten werden. Damit Demokratie gelebt wird, müssen an Kitas- und Schulen Beteiligungs- und Mitbestimmungsformate Standard sein und genutzt werden – was zum Beispiel bedeutet, dass wir weg von konservativen Unterrichtsformen müssen und hin zu einem Unterricht, den Schüler*innen mitgestalten dürfen. Wir fordern des Weiteren sowohl für den frühkindlichen als auch für den schulischen Bereich, dass Partizipationsmöglichkeiten umfassend und regelmäßig evaluiert werden, damit entsprechende Anpassung und Maßnahmen zu Besserung der Situation eingeleitet werden können. Dies muss entsprechen im KiBiz bzw. Schulgesetz festgehalten werden.
6. Bildung, ein ganzes Leben
Unsere Bildungsbiografie endet nicht mit dem Abschluss der Ausbildung, des Studiums oder gar dem Ende der Schule. Bildung begleitet uns von der Geburt bis zum Tod, ein ganzes Leben. Und wenn alles Bildung ist, dann ist das lebenslange Lernen so umfassend wie das Leben selbst. Und die längste Zeit unseres Lebens findet Bildung im außerschulischen Kontakt statt, in Institutionen, aber auch in selbstorganisierten Gruppen. Dieses breite Spektrum kann ein Antrag kaum erfassen, weshalb wir uns an dieser Stelle auf drei Teilbereiche konzentrieren.
Volkshochschulen
Oft wird von Volkshochschulen als den Motoren der gesellschaftlichen Integration gesprochen. Und tatsächlich ermöglichen sie es jedes Jahr vielen Menschen, ihre Schulabschlüsse nachzuholen. Trotzdem werden die Dozent*innen unterdurchschnittlich bezahlt. Meist handelt es sich um Freiberufler*innen auf Honorarbasis oder Ehrenamtler*innen, die das breite Kursangebot überhaupt erst realisierbar machen. Nicht nur deshalb befinden sich die Volkshochschulen in einer schwierigen Lage. In den letzten Jahren wurde immer wieder die Besteuerung von VHS-Kursen diskutiert. Bislang konnte das – auch durch das Engagement der SPD – verhindert werden. Zudem sehen sich die Volkshochschulen sich immer größerer Konkurrenz ausgeliefert, in den vergangenen Jahren sind auch vermehrt private Anbieter*innen auf den Bildungsmarkt gedrängt.
Um sich finanziell über Wasser halten zu können, dominieren teilweise Kurse das Programm, für die die Volkshochschulen hohe Förderungsgelder erhalten. Dabei äußern viele Volkshochschulen den Wunsch, viel mehr politische Bildung anbieten zu können, in enger Kooperation mit lokalen Akteur*innen zusammenzuarbeiten. Das bringt jedoch keine Einnahmen. Mit der Pandemie sind die Teilnehmer*innenzahlen um mehr als 50 Prozent zurückgegangen und die ohnehin angespannte finanzielle Lage der Volkshochschulen hat sich weiter verschärft. Und Digitalisierung? Die erfolgte an den meisten Standorten, wie in so vielen Bildungsbereichen, aus dem Stand als Notfallmaßnahme in der Pandemie.
Volkshochschulen wollen ein Bildungsort für alle Menschen sein: Niedrigschwellig für Einsteiger*innen, anspruchsvoll für Fortgeschrittene. An dem Menschen zusammengebracht werden, die sich in ihrem alltäglichen Leben wahrscheinlich nicht über den Weg laufen würden. Sie wollen integrativ und inklusiv arbeiten, aber dafür müssen auch die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden. Wir wollen die Volkshochschulen auf ihrem Weg dorthin unterstützen.
Unsere Volkshochschulen der Zukunft müssen sich keine Sorgen mehr machen, ob ihre Kurse besteuert werden. Der Staat hat den Menschen gegenüber einen Bildungsauftrag, der nicht mit dem Abschlusszeugnis endet. Der Staat muss Bildung für alle ermöglichen. Steuerfreiheit ist ein wichtiges Instrument, damit die Kurse an den Volkshochschulen bezahlbar bleiben, egal wie hoch das Einkommen der Bildungsempfänger*innen ist. Aber für eine zeitgemäße Infrastruktur braucht es zusätzliche finanzielle Mittel des Landes, um Räumlichkeiten modernisieren und die Technik den Anforderungen des digitalen Lernens anpassen zu können. Mit einer landes- oder bundesweiten Online-Plattform können Volkshochschulen Kompetenzen austauschen, Mittel für eigene Plattformen und Webauftritte einsparen und so voneinander profitieren. Dabei ist klar, dass Online-Kurse die Präsenzangebote nur ergänzen. Volkshochschulen sind soziale Schmelztiegel und leben davon, dass die Menschen dort persönlich aufeinandertreffen.
Weiterhin sollen die Volkshochschulen sicherstellen, dass ausreichend Sprach- und Integrationskurse, Kurse zu handwerklichem Arbeiten oder Alltagskompetenzen angeboten werden, die Menschen in jeder Lebenslage Hilfestellung geben. Aber genauso sollen sie ihre Vorstellungen verwirklichen und mehr politische Bildung anbieten können. Ohne, dass sie dabei finanzielle Engpässe befürchten müssen.
Klar ist, dass die Verbesserungen auch bei den Dozent*innen ankommen müssen. Statt dauerhaft in Befristungen festzuhängen, verdienen sie finanzielle Sicherheit und Perspektiven, die ihnen Lebensplanung ermöglichen. Die Quote der Festanstellungen muss erhöht werden. Das ist allein schon sinnvoll, weil es in jedem Semester wiederkehrende Kurse gibt, etwa Englisch- und Französisch-Sprachkurse. Außerdem werden so endlich die Vor- und Nachbereitungen von Kursen entlohnt.
Mittelfristig wollen wir mit der Einführung eines Bildungsgutscheins sicherstellen, dass alle Menschen einmal im Semester einen Kurs ihrer Wahl kostenfrei besuchen können. Auch dafür sollen Landesmittel bereitgestellt werden. Langfristig ist das Ziel, dass alle Bildungsangebote der Volkshochschulen kostenlos angeboten werden können. So machen wir lebenslanges Lernen von einer Floskel zu einem konkreten politischen Projekt, dass die Bildungssituation der Menschen im Land verbessern. Wir wollen die Menschen für Bildung begeistern und dafür sorgen, dass ihr Qualität weder vom Geldbeutel noch von anderen individuellen Startvoraussetzungen abhängt.
Gewerkschaftliche Bildung
Die Gewerkschaften leisten in ihren Seminaren eine umfassende berufliche und politische Bildungsarbeit. Das geht weit über Tages- oder Wochenendveranstaltungen hinaus, gewerkschaftliche Bildungsveranstaltungen finden teilweise über Zeiträume von bis zu zwei Wochen statt. Dafür müssen Arbeitnehmer*innen Bildungsurlaub beantragen, wobei ihnen viele Arbeitgeber*innen kaum entgegenkommen. Denn Arbeitnehmer*innen haben in NRW lediglich einen Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr, Auszubildende sogar nur auf fünf Tage explizit für politische Bildungsarbeit während ihrer Ausbildung. Geregelt ist dies im Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz des Landes.
Es braucht flexiblere Modelle, damit Arbeitnehmer*innen nicht den Jahresurlaub für die eigene Weiterbildung nutzen müssen oder nur alle paar Jahre Seminare der Gewerkschaften besuchen können. Hier liegt die Bringschuld bei den Arbeitgeber*innen, die viel mehr politische Bildungsarbeit ermöglichen und Bildungsurlaub gewähren müssen. Den Anteil der Arbeitnehmer*innen, die politische Bildungsarbeit der Gewerkschaften wahrnehmen, liegt aktuell zwischen 0,1 und 1 Prozent. Zeit, das zu ändern.
Bildung im Gefängnis
Ein Bereich, der viel zu oft aus den Augen verloren wird, ist die Bildung und Weiterbildung im Gefängnis und die äußerst wichtige Aufgabe der Resozialisierung. Bildung muss für uns nicht nur lebenslang andauern, sie muss auch alle Lebensbereiche, Institutionen und Lebensabschnitte miteinbeziehen – auch die, die man zunächst nicht im Blick hat und dazu gehört auch die Zeit während einer Gefängnisstrafe. Grundsätzlich muss klar sein, dass jede Haftstrafe einen immensen, leider oftmals negativen, Einfluss auf die Insass*innen hat, nicht ohne Grund „Schule des Verbrechens“ genannt wird und Rückfallquoten in der Bundesrepublik in die Höhe treibt. Die Gefängnisstrafe darf niemals ein Konstrukt sein, welches nur der Bestrafung aufgrund einer vorher begangenen Strafe dient – sie soll und muss auch eine reale Chance der Resozialisierung bieten. Dies ergibt sich nicht nur aus den allgemein anerkannten Resozialisierungszielen der Bundesländer, die aus den Menschenrechten der Insass*innen resultieren, sondern auch aus einer antikapitalistischen Sicht auf das Konstrukt der Gefängnisstrafe. Zunächst muss man immer im Hinterkopf behalten, dass der Großteil der Menschen nur eine kurze Haftstrafe für bis zu einem Jahr bekommen, welches in vielen Fällen auf die Schwere der Tat zurückschließen lässt. Hinzu kommt, dass auch ein großer Teil davon Menschen sind, bei denen die Geldstrafe uneinbringlich ist und im Zuge dessen eine Ersatzfreiheitsstrafe ausgesprochen wird. Dies zeigt, dass die Gefängnisstrafe von einem Mittel die schwersten Verbrechen der Gesellschaft zu bestrafen, zu einem Instrument geworden ist, welches besonders die marginalisierten Menschen betrifft, deren sozialen und finanziellen Sicherungssysteme von vornherein schwach ausgebaut sind. Berechtigterweise wird von Kriminolog*innen und Strafrechtler*innen auch kritisiert, dass White-Collar-Crimes (Wirtschaftskriminalität wie z.B. der Cum-Ex und Cum-Cum Skandal) viel seltener strafrechtlich verfolgt werden als Blue-Collar-Crimes (Straftaten der „Arbeiter*innenklasse“). Das Konstrukt der Ersatzfreiheitsstrafe ist daher nicht ohne Grund schon länger scharf in der Kritik, vor allem deswegen, weil viele Gefängnisstrafen durch soziale Arbeit abgewendet werden könnten.
Diese kurze Haftzeit reicht leider auch oftmals nicht aus, um Resozialisierungsmaßnahmen ordentlich anwenden zu können. Daher werden teilweise sogar Insass*innen mit einer „nur kurzen“ Haftstrafe gar nicht in Programme eingebunden, da diese nicht fruchten würden. Daher ist aus einer jungsozialistischen Perspektive an verschiedenen Stellen anzusetzen. Zunächst einmal müssen äußere Umstände geschaffen werden, dass Menschen, die ihre Geldstrafe nicht zahlen können, durch andere Systeme aufgefangen werden und nicht direkt im Gegenzug eine Haftstrafe absitzen müssen. Jede Haftstrafe, die abgewendet werden kann, sollte abgewendet werden und durch effektivere Maßnahmen, wie eine soziale Betreuung und soziale Arbeit ersetzt werden. Wenn eine Haftstrafe unabdingbar ist, müssen die Maßnahmen innerhalb der Anstalt massiv ausgebaut und unterstützt werden, dazu gehört auch die Stärkung der Aus- und Weiterbildung im Gefängnis. Arbeit, Ausbildungen und Fernstudien sind essenzielle Pfeiler der Resozialisierung während der Haftzeit und dürfen nicht nur als Systeme begriffen werden, die nur dann wertvoll sind, wenn sie profitabel sind. Denn noch viel zu oft wird Arbeit in den Haftanstalten von Unternehmen deswegen angeboten, weil die Arbeitskraft günstig ist und damit die Herstellung unter dem Strich profitabler ist. Hier muss ein Umdenken stattfinden. Die Arbeit im Gefängnis unterscheidet sich nicht von der Arbeit außerhalb des Gefängnisses. Sie muss gerecht entlohnt werden und es müssen landesrechtliche Regelungen für die Einzahlung in die Renten- und Krankenkasse geschaffen werden, um die Lücke zu schließen und eine Einzahlung zu ermöglichen, damit Insass*innen nicht auch über die Haftzeit hinweg bestraft werden. Bildung muss für alle Menschen zugänglich sein und damit auch für diejenigen, die von der Gesellschaft als abgeschrieben gelten.
7. Schluss
Der vorliegende Antrag ist ein Meilenstein im Rahmen unseres groß angelegten Bildungsdialogs, den wir als NRW Jusos zu Beginn des Jahres gestartet haben. Er ist das Ergebnis des digitalen Bildungsgipfels, unserer Sommerschule und der vielen Diskussionen, die wir als Verband miteinander und mit externen Expert*innen geführt haben. Mit dieser Grundlage machen wir uns nun auf, um für unsere Positionen im Zulauf auf die kommende Landtagswahl zu werben. Unser Ziel ist klar: Ein Bildungssystem, das Teilhabe ermöglicht, statt sie zu verhindern und das allen Menschen die Möglichkeit gibt, das Leben zu führen, was sie führen möchten. Dafür braucht es den Neustart Bildung.
[1] McKinsey Global Institute: „Skill Shift. Automation and the Future oft he Workforce“, 2018.