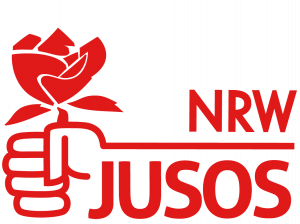Welche Sofortmaßnahmen helfen bei Verbrennungen? Wie überprüfe ich die Vitalfunktionen, wie Bewusstsein, Atmung, Kreislauf? Was ist ein AED? Wie nehme ich überhaupt Kontakt zum Rettungsdienst auf? Hierbei handelt es sich um Fragen, die in einem Erste-Hilfe-Kurs besprochen werden und wo man konkrete Hinweise an die Hand bekommen würde. In Deutschland ist ein verpflichtender Erste-Hilfe-Kurs nach wie vor an den Erwerb des Führerscheins gekoppelt. Hierbei handelt es sich jedoch um ein veraltetes Modell. Nicht jede*r macht noch einen Führerschein und auch ist fraglich, warum der Erste-Hilfe-Kurs, wenn man ihn schon an den Führerschein koppelt, nicht in regelmäßigen Zeitabständen aufgefrischt werden muss. Die Bilanz zeigt, dass jede achte Person in Deutschland noch nie einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat und bei den anderen liegt er meist viele Jahre zurück. Auch haben wenige Menschen Kenntnis über Erste-Hilfe-Apps oder öffentliche Hilfsmittel wie einen Defibrillator. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele aus Angst und Unwissenheit etwas falsch zu machen in notwendigen Situationen nicht handeln. Doch feststeht: Das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung könnten in Deutschland durch sofortige Hilfen von Laien jährlich bis zu 10.000 Menschenleben mehr gerettet werden.
Sensibilisierung der Gesellschaft
Bloß jede*r fünfte Deutsche traut sich die Ausübung von lebensrettenden Maßnahmen (Stoppen von starken Blutungen, bei Atemstillstand beatmen, Herzdruckmassage, etc.) zu. Die Reanimationsquote liegt hierzulande nur bei 40 Prozent, während der europäische Durchschnitt bei 52 Prozent liegt und in den skandinavischen Ländern sind es sogar 60 bis 80 Prozent. Expert*innen halten die Differenz für so groß, weil dort ein besseres Problembewusstsein herrsche und auch bereits in Schulen das Thema Erste-Hilfe behandelt wird. Überall kann etwas passieren: beim Sport, in der Kneipe, beim Reisen, im Haushalt, auf der Arbeit oder im Verkehr. Durch das Gesetz sind wir verpflichtet zu helfen, sonst drohen Strafen, aber haben wir verlernt Hilfe zu leisten?
2016 war der Fall einer Bankfiliale in Essen in vielen Medien zu sehen und hat eine Diskussion rund um das Thema Erste-Hilfe ausgelöst. Ein sterbender Mann war im Vorraum der Bank von weiteren Kund*innen ignoriert worden. Keine*r wollte helfen. Der Mann starb eine Woche später an den Folgen seines Zusammenbruchs und die Augenzeug*innen mussten eine Geldstrafe zahlen. Alle gaben an, dass sie dachten, es handele sich um einen schlafenden Obdachlosen. Doch obdachlos oder nicht, warum sind viele in der Gesellschaft nicht bereit zu helfen oder trauen sich noch nicht mal auf dem Boden liegende Menschen zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Auch zahlreiche Autounfälle werden von Menschen in vorbeifahrenden Autos zwar gerne bestaunt, geholfen oder zumindest der Notruf gewählt, wird nur selten. „Das macht schon wer anders.“
In vielen Fällen kommen Menschen erst auf die Idee ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen, wenn sie selbst in eine unvorhergesehene Situation gekommen sind oder selbst Hilfe in Anspruch nehmen mussten. So gab es laut des Deutschen Roten Kreuzes eine hohe Nachfrage an Erste-Hilfe-Kursen nach der „Loveparade-Katastrophe“ in Duisburg. Doch warum gehört es in unserer Gesellschaft nicht völlig selbstverständlich dazu, dass beispielsweise alle fünf Jahre ein Erste-Hilfe-Kurs besucht wird.
Außerdem sollte es in den Schulen selbstverständlich zu den Lehrinhalten gehören. Etwa im Rahmen einer Projektwoche o.Ä. Denn je früher Menschen selbstverständlich mit dem Begriff Helfen konfrontiert werden, desto größer ist auch die Bereitschaft im Ernstfall wirklich Hilfe zu leisten. Auch wird das Gelernte zu Hause den Eltern oder Geschwistern gezeigt, wodurch das Thema insgesamt an Präsenz in deutschen Haushalten gewinnt. Außerdem besteht auch ein Eigeninteresse der Schulen an einem ganzheitlichen Erste-Hilfe-Konzept für Schulen, denn im Zuge des Ganztags spielt sich auch immer mehr Leben am Lernort Schule ab. Die Anzahl an Schulunfällen ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen, während jedoch bei Betrieben eine Ersthelfer*innen-Quote gesetzlich festgelegt ist und andere Auflagen für den Notfall erfüllt werden müssen, gibt es für Schulen keine einheitlichen Regelungen. Es reicht also nicht, wenn nur Sportlehrer*innen über ein Zertifikat verfügen.
Auch kommt der Rettungsdienst in Deutschland oft an seine Grenzen. Die Einsatzzahlen nehmen, bei gleichzeitig steigendem Personalmangel, zu. Das System Notfallversorgung krankt an vielen Stellen und in vielen Orten. Es wird daher immer wichtiger, dass wir als Laien in der Lage sind Wartezeiten zu überbrücken und uns gegenseitig zu helfen. Zehn Minuten können wertvolle Zeit für einen verletzten Menschen sein. Durch die stetige Übung in Kursen werden gewisse Abläufe, Techniken oder Handgriffe erlernt und die Teilnehmer*innen werden sich so auch ruhiger und überlegter in Extremsituationen verhalten können. Dabei geht es zu keinem Zeitpunkt etwa darum die Arbeit der Sanitäter*innen oder eine*r Notärzt*in zu übernehmen. Aber es fängt bereits beim richtigen Sichern einer Unfallstelle an. Durch Rollenspiele kann das Telefongespräch mit der Notzentrale erprobt werden. Was für Informationen sind relevant und gebe ich weiter? Welche Körpersignale deuten auf welches Krankheitsbild hin. Es geht darum, Menschen zu ermutigen im Ernstfall zu*r Lebensretter*in zu werden und Ängste und Hemmschwellen abzubauen.
Digitalisierung auch in der Ersten Hilfe!
Viele Orte verfügen bereits über die sogenannten Automatisierten Externen Defibrillatoren (AEDs). Es handelt sich dabei um ein hoch technisch entwickeltes Gerät, das den Herzrhythmus selbstständig analysiert und entscheidet, ob ein Impuls notwendig ist. Nur wenn erforderlich, wird diese Funktion des Gerätes freigegeben und die Anwender*innen mittels Sprachanweisung aufgefordert, den Impuls per Knopfdruck auszulösen. Eine wichtige Errungenschaft in der Ersten-Hilfe, denn der plötzliche Herztod, ausgelöst durch Kammerflimmern, ist außerhalb von Krankenhäusern die häufigste Todesursache. Meist ohne vorherige Anzeigen versterben jährlich über 100.000 Menschen am plötzlichen Herzstillstand. Die Erste-Hilfe in den ersten Minuten, vor allem mit Hilfe des Laien-Defibrillators, hat eine enorme Relevanz, denn das Gehirn beginnt bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand bereits nach nur drei bis fünf Minuten ohne Blutfluss unwiederbringlich zu sterben. Das Warten von bis zu 15 Minuten auf den Krankenwagen muss überbrückt werden. Der Schockgeber kann hier die übliche Reanimation unterstützen. Durch ein leicht verständliches Display und akustische Aussagen werden Anweisungen zur Reanimierung gegeben. Das Gerät ist extra für Laien konzipiert! Dennoch trauen sich laut Umfragen nur 50% die Verwendung zu. Hier muss, wie bereits angesprochen, die Teilnahmefrequenz an den Erste-Hilfe-Kursen steigen und auch ist es besonders wichtig, dass die AEDs verpflichtend an möglichst vielen Orten (vor allem an Risikoorten wie Fitnessstudios, Bahnhöfen, etc.) zur Verfügung stehen. Auch ist vielen nicht bewusst, dass sie ihr Smartphone mit Erste-Hilfe-Apps ausstatten und so in Notfallsituationen benutzen können. Diese sind von den bekannten Rettungsdiensten entwickelt worden, und erklären mit Hilfe von Bildern und sprachlichen Anweisungen, welche Handlungen Schritt für Schritt nötig sind. Bei vielen Anwendungen ist auch ein Notruf-Assistent integriert oder spezielle Notrufnummern wie die Giftnotrufzentrale o.Ä.
Längst haben, bis auf einige Ausnahmesituationen, die Smartphones die Notrufsäulen abgelöst. Jedoch nicht, wenn man sich die speziell entwickelte Notrufsäule vom US-Konzern Google anschaut. Diese hat die Möglichkeit eine Drohne zur medizinischen Versorgung anzufordern. So haben Menschen die Möglichkeit diese Drohne mit Defibrillatoren, Pulsoximetern, Inhalatoren und Medikamente wie Adrenalin oder Insulin zu erhalten. Die Drohne soll direkt zum Unfallort fliegen und medizinische Unterstützung liefern, bevor Rettungssanitäter*innen vor Ort sind. Auch soll über die Notrufsäule der direkte Austausch mit eine*r Rettungsassitent*in möglich sein. So wird lebenswichtige Zeit gewonnen wie in Fällen eines anaphylaktischen Schocks.
Zusammenfassung
Wie der Antrag gezeigt hat, kann jede*r den Ausgang eines Notfalls beeinflussen und zum Überleben des Opfers beitragen. Dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten bei der Ersten-Hilfe und auch neue Technologien können uns dabei unterstützen.
Deshalb fordern wir:
- Die fachlich fundierte Thematisierung von Erste-Hilfe an KiTa’s und Schulen.
- Öffentliche Kampagnen zur Sensibilisierung der Gesellschaft zu helfen und die Relevanz von Erste-Hilfe Kenntnissen ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken.[1]
- Zum Erhalt des Führerscheins muss der Erste-Hilfe-Kurs alle fünf Jahre wiederholt werden.
- Flächendeckender Zugang zu Automatischen Externen Defibrillatoren (AED). Besonders an öffentlichen Orten mit großer Menschenansammlung (Bahnhöfen, Flughäfen, etc.) oder an Orten mit besonders hohem Risikofaktor (Fitnessstudios, Sporthallen, etc.).
- Defibrillations- und Insulindrohnen im ländlichen Raum einführen.
- Europäische Standards für Erste-Hilfe.
- Erste-Hilfe-Fortbildungspflicht für Erzieher*innen, Lehrer*innen und Trainer*innen.
- Forschungsgelder für den Ausbau digitaler Hilfen in der Ersten-Hilfe (Drohnen, AED, etc.)
[1] Ähnlich wie bei der Kampagne zur Bildung einer Rettungsgasse auf Autobahnen.