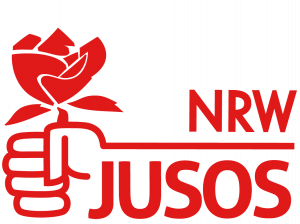Die Ausgangslage
Gut sieben Monate vor der Landtagswahl sieht es düster aus in Nordrhein-Westfalen. Die schwarz-gelbe Landesregierung kriegt die Corona-Zahlen nicht in den Griff. Leidtragende sind dabei vor allem Kinder und Jugendliche, die sich nicht nur mit einer hohen Inzidenz in ihrer Altersgruppe abfinden müssen und deren Bedürfnisse während der Pandemie grundsätzlich an letzter Stelle beachtet werden. Sie befinden sich außerdem schon im zweiten Jahr ihrer Bildungsbiografie, in dem sich soziale Ungleichheiten massiv verschärfen, weil die politisch Verantwortlichen nicht willens oder zu inkompetent waren, um Bildung und damit Zukunftschancen adäquat zu gewährleisten.
Nach Zukunftschancen suchten auch viele junge Erwachsene in Form eines Ausbildungsplatzes vergeblich. Zu viele blieben nach ihrem Schulabschluss im Wartesaal des Lebens hängen und konnten nicht den nächsten so wichtigen Schritt in ein eigenständiges Leben gehen. Und bei vielen Jugendlichen, die ohne Abschluss die Schule verlassen haben, weiß die Landesregierung noch nicht mal, was diese eigentlich gerade machen. Ohne Begleitung und Förderung steht ihnen ein Leben in prekären Verhältnissen bevor. „Kein Kind zurücklassen“ – das war einmal in NRW.
Nicht zuletzt verbaut die Landesregierung unser aller Zukunftschancen mit ihrer gestrigen Klima- und Industriepolitik, was gerade für ein erfolgreiches Industrieland wie Nordrhein-Westfalen eine Katastrophe ist. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) bescheinigte NRW in einer Studie aus dem Jahr 2019, dass nur noch ein anderes Bundesland weniger Erfolge beim technologischen und wirtschaftlichen Wandel vorzeigen kann als NRW – das Saarland. Bei den Erneuerbaren Energien schmückt sich die Laschet-Regierung mit den Ausbau-Zahlen in der Windkraft, für die noch die letzte rot-grüne Regierung verantwortlich ist und stoppt im Hier und Jetzt durch die 1.000 Meter-Abstandsregel faktisch jeglichen weiteren Ausbau. So ist eine erfolgreiche sozial-ökologische Transformation nicht zu machen.
Es sieht also düster aus in NRW und eigentlich könnte man die Plakat-Parolen der CDU aus dem letzten Landtagswahlkampf jetzt wieder plakatieren. Keines ihrer Versprechen haben sie in den letzten dreieinhalb Jahren eingelöst. Aber uns geht es nicht um das, was war. Sondern um das, was sein sollte. Wir wollen dafür sorgen, dass es heißt: Im Westen geht die Sonne auf.
Dazu machen wir uns gerade gemeinsam mit der NRWSPD in kritischer Solidarität auf den Weg, um ein Zukunftsprogramm für das NRW von morgen zu schreiben. Wir wollen die schwarz-gelbe Landesregierung ablösen. Nicht als Selbstzweck, sondern weil wir finden, dass vier Jahre lang genug kaputt gemacht wurde. Wir wollen in NRW anpacken und das Leben der Menschen hier ganz konkret verbessern. Wir werden Zukunftschancen schaffen und dafür sorgen, dass in NRW alle, das Leben führen können, was sie führen möchten. Dafür formulieren wir anhand dreier Schwerpunkte Forderungen, die sich aus jungsozialistischer Perspektive im Zukunftsprogramm der NRWSPD für die Landtagswahl wiederfinden müssen. Unsere Schwerpunkte lauten: Bildung für alle, Gute Arbeit und Ausbildung und die sozial-ökologische Transformation als Erfolgsgeschichte. Und hier kommen unsere Forderungen:
Bildung für alle
Aus jungsozialistischer Perspektive ist Bildung die entscheidende Grundvoraussetzung dafür, dass jeder Mensch das Leben führen kann, was er oder sie führen möchte. Auch mit Blick auf unsere sozialdemokratische Geschichte hatte Bildung stets das emanzipatorische Potential, Klassenbewusstsein zu schaffen, Teilhabe zu ermöglichen und die soziale Lage der eigenen Schicht zu verbessern. Ob es die Arbeiter*innenbildungsvereine aus der Anfangszeit unserer Bewegung waren, die eine zentrale Mobilisierungsfunktion innehatten oder die Bildungspolitik der SPD in den 60er und 70er Jahren, die zu einer massiven Demokratisierung der Bildungsinstitutionen führte und das Versprechen vom Aufstieg durch Bildung für viele wahr machte, für die es ohne diese sozialdemokratische Reformpolitik unerreichbar geblieben wäre.
Aber wenn wir unseren Blick auf das Bildungssystem von heute richten, müssen wir feststellen, dass das Versprechen vom Aufstieg durch Bildung nicht mehr gilt. Die Zeiten, in denen es ‚unseren Kindern mal besser gehen sollte‘, scheinen vorbei. Die eigene Herkunft entscheidet viel zu sehr über die eigene Zukunft. Die unterschiedlichen Bedingungen, mit denen Menschen auf die Welt kommen und die das Bildungssystem ausgleichen müsste, werden stattdessen reproduziert. Schon Kinder und Jugendliche erleben Klassismus, Sexismus und Rassismus. Zukunftschancen werden nicht ermöglicht, sondern verhindert. Erst kürzlich stellte der DGB anlässlich einer veröffentlichten Expertise des Bildungsforschers Klaus Klemm fest: „Die soziale Spaltung bleibt die offene Wunde unseres Bildungssystems.“
Damit können und wollen wir uns nicht länger abfinden. Als NRW Jusos fordern wir ein Bildungssystem, dass allen Menschen ermöglicht, sie selbst zu werden, sich zu verwirklichen und das Leben zu führen, das sie führen möchten – egal wie viel Geld ihre Eltern haben, wie sie aussehen, wen sie lieben oder mit welchem Geschlecht sie sich identifizieren. Um das zu erreichen, müssen wir Bildung in der vollen Breite in den Blick nehmen – von der frühkindlichen Bildung über Grundschule und weiterführende Schule, bis zur Ausbildung oder zum Studium und darüber hinaus. Unsere Vorstellung eines gerechteren Bildungssystems ist durch einen hohen Grad an Diversitätssensibilität, Demokratiepädagogik und Digitalisierung gekennzeichnet.
Wir wollen nicht länger von Chancengleichheit schwafeln und im Tunnel der Problemanalyse stecken – wir wollen die Bildungsungerechtigkeit aktiv bekämpfen, die durch Klassismus, Rassismus, Ableismus und Queerfeindlichkeit befördert wird.
Und wir fordern unsere Partei dazu auf, gemeinsam mit uns mutig zu sein und die dringend notwendigen Reformen anzugehen. Nach dem bildungspolitischen Stillstand durch mehr als 10 Jahre Schulfrieden, braucht es nun einen echten Neustart in der Bildungspolitik Nordrhein-Westfalens. Wir dürfen uns nicht länger nur mit kleinen Reparaturen an einem falschen System begnügen, sondern müssen große Schritte gehen, um ein Bildungssystem zu schaffen, das allen Kindern und Jugendlichen Teilhabe ermöglicht, anstatt sie weiter zu verhindern.
Dazu fordern wir:
- Konkrete Schritte hin zu einem integrierten und gerechten Schulsystem. Dazu gehören u.a.:
- eine Kultur des Behaltens an den Gymnasien in NRW; keine Abschulung mehr von einmal aufgenommenen Kindern.
- die Ermöglichung einer Sekundarstufe II am Standort der Sekundarschulen
- eine stärkere Unterstützung der integrierten Schulen, die Großes leisten, hinsichtlich finanzieller und personeller Ressourcen.
- die Einsetzung einer Kommission aus Bildungsexpert*innen (Schüler*innen, Lehrer*innen, Forschende), die einen Vorschlag zur Überarbeitung der Lerninhalte erarbeiten soll. Für uns stehen dabei die Prinzipien demokratische Bildung, Selbstreflexion und Selbstständigkeit im Mittelpunkt. Ein neues Lernkonzept muss Antworten auf die Probleme von Schüler*innen liefern und das notwendige Wissen und die entsprechenden Fähigkeiten für ein selbstständiges Leben als mündige Bürger*innen vermitteln. Dieses Lernkonzept soll nicht nur bestehende Fächer überprüfen und potenzielle weitere Fächer evaluieren, sondern auch das grundsätzliche Lernen in Form von Schulfächern oder im festen Schulklassenverband hinterfragen und bei Bedarf alternative Möglichkeiten aufzeigen. Dabei sollen auch Lerngruppenübergreifende Lernmethoden berücksichtigt werden.
- eine Schule ohne Noten. Stattdessen brauchen wir ein neues Beurteilungssystem, dass die individuellen Lebenslagen von Schüler*innen berücksichtigt und eine fördernde Lernkultur schafft. Schüler*innen müssen künftig an Leistungsbewertungsprozessen partizipieren dürfen und diese sollten in dialogischen und fördernden Bewertungsräumen erfolgen.
- eine deutliche Weiterentwicklung des Ganztags. Im Ganztagsbereich sollen Jugendliche nicht nur betreut werden, sondern es braucht ein breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften aus dem naturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, linguistischen, kulturellen und sportlichen Bereich, in denen sie wichtige Schlüsselkompetenzen außerhalb des Lernstoffs erlernen können. Lokale Initiativen und Vereine sind aus unserer Sicht dabei sinnvolle Kooperationspartner*innen. Schließlich braucht es im Ganztag auch flexible Angebote, die nicht unbedingt im institutionalisierten Bereich der Agen stattfinden müssen. Schüler*innen brauchen auch die Möglichkeit, selbstorganisiert mit Mitschüler*innen Projekte umzusetzen oder sich auch zur Eigenarbeit zurückziehen zu können.
- die Inklusion endlich richtig umsetzen. Damit das gelingt, braucht es mehr Personal vor allem bei den Assistenzen als Teil eines multiprofessionellen Teams, damit nicht länger Sozialpädagog*innen diese Aufgabe mit übernehmen, wie es häufig im Schulalltag der Fall ist. Außerdem ist zu überlegen, ob ein Verzicht auf die Förderschwerpunkte möglich ist, da diese häufig zu einem vorschnellen Labeln führen. Wir wollen Inklusion so gestalten, dass die Kinder und ihre Eltern selbst entscheiden können, welche Teile des Schullebens in einem inklusiven Unterricht stattfinden sollen und wo es vielleicht auch einen notwendigen Schutzraum braucht. All das aber unter einem Dach, in einem System und mit einem Kollegium und nicht in zwei getrennten Parallelsystemen. Zusätzlich beobachten wir, dass die Bebauung von Schulgebäuden immer noch inklusionsgefährdende Mängel aufweist. Durch mangelnde Barrierefreiheit der Gebäude und Schulräume ist eine echte Inklusion kaum möglich – auch hier müssen vor allem den Kommunen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit sie ableistische Architekturen modernisieren können.
- Unser Ziel bleibt eine Schule für alle, an der alle Kinder und Jugendlichen von der ersten Klasse bis zu ihrem jeweiligen Abschluss an einem wohnortnahen Standort unterrichtet werden. Auf dieser Schule für alle findet ein binnendifferenzierter Unterricht in kleinen Klassen statt, in denen sich multiprofessionelle Teams um die individuellen Bedürfnisse der Schüler*innen kümmern. Und an dieser Schule für alle können sämtliche Schulabschlüsse erreicht werden.
- Für eine diverse Bildung an Schulen fordern wir:
- die Schaffung von diskriminierungsfreien Bildungsstrukturen. Darunter verstehen wir, dass kontinuierliche und reflexive Diversitätssensibilisierungsangebote für Lehrkräfte zum Standard werden und bereits im Ausbildungsprozess eine verpflichtende Rolle einnehmen. Für von Diskriminierung Betroffene fordern wir bedarfsgerechte Empowermentstrukturen, die durch externe Akteur*innen begleitet werden.
- die Schaffung von Antidiskriminierungsstellen als Schutzstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern, bei denen sie Diskriminierungs- und Rassimusfälle melden und sich beraten lassen können. Auch diese Stellen sollten von externen Akteur*innen besetzt werden.
- diversitätssensible Lerninhalte insbesondere zu den Themen Migration, Rassismus und Antisemitismus, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sowie Feminismus, die ebenfalls von der von uns geforderten Kommission berücksichtigt werden müssen.
- Für eine demokratische Bildung von Anfang an fordern wir:
- die verbindliche Einsetzung von Partizipationselementen in frühkindlichen Bildungseinrichtungen. Dies kann in Form eines Kinderparlaments oder auch einer Kinderversammlung erfolgen. Darüber hinaus fordern eine bestimmte Anzahl an projektbezogener Beteiligung im Jahr mit den Kindern durchzuführen, damit diese an den Entscheidungen beispielsweise zu (räumlichen) Veränderungen innerhalb der Einrichtung oder bei der Auswahl eines Ausflugsziels partizipieren können.
- die generelle Einbindung von Mitbestimmungselementen in den Kita-Alltag, z.B. wenn es um die Spielgestaltung, um Gruppenregeln oder die Interaktion mit den Erzieher*innen geht. Grundsätzlich ist dabei auch darauf zu achten, dass jedes Kind gesehen wird, auch wenn es beispielsweise aufgrund von Sprachbarrieren nicht jede Form der Mitbestimmung wahrnehmen kann.
- Für eine angemessene digitale Bildung fordern wir:
- massive Investitionen in digitale Infrastruktur, Entwicklung und Bereitstellung guter digitaler Lernsoftware und -hardware und entsprechender Lerninhalte sowie ein umfangreiches Aus- und Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte. Darüber hinaus braucht es zusätzliches Fachpersonal, das bei der Implementierung und kontinuierlichen Begleitung der Hard- und Software unterstützt.
- Beste Bildung braucht ungebremste Investitionen, damit
- der Schulneubau und die teilweise dringend notwendige -sanierung ausreichend finanziert ist.
- wir durch einen deutlichen Ausbau der Betreuungsplätze an Kitas und Ganztagsschulen endlich den Rechtsanspruch auf Kita- und Ganztagsplätze erfüllen.
- wir die Gebührenfreiheit von der Kita bis zum Abschluss gewährleisten. Darüber hinaus wollen wir jedem Kind eine Sportvereinsmitgliedschaft für ein Jahr, einen kostenfreien Büchereiausweis über die gesamte Schulzeit sowie ein kostenloses warmes und gesundes Mittagessen finanzieren.
- Ungleiches auch ungleich behandelt wird. Durch einen einrichtungsscharfen Sozialindex wollen wir dafür sorgen, dass zusätzliches Geld und Personal da ankommt, wo es am dringendsten benötigt wird.
- Beste Bildung braucht bestes Personal. Das heißt für uns:
- Wir brauchen mehr Personal an den Kitas und Schulen, um eine bestmögliche Betreuung zu gewährleisten. Multiprofessionelle Teams, die Lehrkräfte, Assistenzen und Sozialpädagog*innen umfassen, müssen an den Schulen NRWs zum Standard werden.
- Wir werden prekäre Arbeitsbedingungen im Bildungssystem beseitigen. Dazu gehört die Entfristung von befristeten Verträgen und die Bezahlung nach Tarifverträgen für alle erzieherischen und pädagogischen Akteur*innen in den verschiedenen Funktionen. Außerdem fordern wir A13 als Einstiegsgehalt für alle Lehrer*innen unabhängig von der Schulform.
- Gerade die Schulsozialarbeit werden wir ausfinanzieren und durch eine Personaloffensive, inklusive der Entfristung der Verträge und einer anständigen Bezahlung, dafür sorgen, dass ihre wichtigen Beratungs- und Betreuungsangebote flächendeckend zur Verfügung stehen.
- In der frühkindlichen Bildung muss die Ausbildung endlich vergütet und die Fort- und Weiterbildung verbessert und ausgebaut werden. Auch in den Grund- und den weiterführenden Schulen brauchen wir ein breites Fort- und Weiterbildungsangebot für unsere Lehrkräfte.
- Die Rückkehr zum Prinzip „Kein Kind zurücklassen“. Das heißt für uns:
- Das flächendeckende Berufsorientierungsprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) muss so weiterentwickelt werden, dass wirklich niemand mehr beim Übergang von der Schule in den Beruf auf der Strecke bleibt. Dazu braucht es zielgruppenspezifischere, lebensweltorientierte und zusätzlich digitale Angebote für diejenigen, die das Programm zurzeit nicht erreicht: junge Menschen, die innerlich mit der Schule abgeschlossen haben und kaum noch erscheinen; junge Menschen mit Fluchterfahrung, die erst im Laufe der Berufsorientierung dazustoßen und bei denen ggf. Sprachbarrieren vorliegen sowie Jugendliche, die zwar Schwierigkeiten beim Schulabschluss haben, aber hochmotiviert eine Ausbildung beginnen möchten. Ziel des so weiterentwickelten KAoA muss es sein, dass junge Erwachsene nicht endlos Maßnahmen absolvieren, sondern so gefördert werden, dass sie den beruflichen Werdegang einschlagen können, den sie einschlagen möchten.
- Den schwarz-gelben Roll-Back in der Hochschulpolitik abwickeln. Dazu fordern wir:
- die Abschaffung von Anwesenheitspflichten, die nicht zu einem freien und selbstbestimmten Studium passen.
- eine konsequente Demokratisierung der Hochschulen. Ob im Senat oder in den Kommissionen – wir fordern die paritätische Besetzung der Gremien. Auch bei Entscheidungen des Rektorats brauchen Studierende durch eine*n studentische*n Prorektor*in Mitspracherecht. Schließlich dürfen Entscheidungskompetenzen nicht in extern besetzte Runden wir den Hochschulrat verlegt werden. Und die SHK-Vertretungen müssen bleiben.
- Frauen in die Lehrstühle. Wir fordern konkrete Maßnahmen zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft. Dazu gehören Mentoringprogramme und Karriereberatungsstellen für Frauen, eine verbindliche Frauenquote von mindestens 50 % bei Neueinstellungen und eine Stärkung des Einflusses von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.
- Diversität an Hochschulen: Genauso wie Schulen, weisen auch Hochschulen deutliche Diversitätsmängel auf. Einige Hochschulen haben sich in der Vergangenheit vorbildlich mit einem Diversitätmanagement auseinandergesetzt. Das ist allerdings nicht flächendeckend zu erkennen. Genauso wie an Schulen, fordern wir deshalb, dass Hochschulen diskriminierungsfreie Hochschulstrukturen schaffen sollten. Für ein Diversitäts- und Antidiskriminierungsmanagement sind folgende Aspekte entscheidend: die Schaffung von verpflichtenden Diversitätssensibilisierungsangeboten für Dozierende und Studierende, die Schaffung von Antidiskriminierungsstellen und die Vermittlung von diversitätssensiblen und rassismuskritischen Lerninhalten.
- gute Arbeit an den Hochschulen durch eine Bundesratsinitiative zur Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Es muss Schluss sein mit prekären Beschäftigungsverhältnissen durch immer wieder neue befristete Verträge und Arbeitszeiten, die einem selbstverwirklichten Leben z.B. in Form von Familie entgegenstehen.
- eine Bundesratsinitiative für ein elternunabhängiges BAföG sowie eine Rückkehr zum Vollzuschuss.
- eine Ausfinanzierung der Studierendenwerke, sodass die Semesterbeiträge bezahlbar bleiben und ausreichend bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann.
Gute Arbeit und Ausbildung
Arbeit ist in unserer Gesellschaft, im Leben jeder und jedes Einzelnen und für unseren Verband zentral. Erwerbsarbeit strukturiert unsere Biographien und unseren Alltag, hat großen Einfluss auf unser Sozialleben und ermöglicht ökonomische Partizipation.
Deshalb ist es von elementarer Bedeutung für unser jungsozialistisches Verständnis einer gerechten Gesellschaft, dass Arbeit gute Arbeit ist: Faire Arbeitsbedingungen, echte Mitbestimmung, gerechte Entlohnung und grundsätzlich zugänglich für alle. Berücksichtigt werden muss dabei auch, dass Care-Arbeit und Erwerbsarbeit in einem sich wechselseitig beeinflussenden Verhältnis stehen und Gender-Unterschiede dadurch entweder verringert oder vergrößert werden können.
Für junge Menschen gibt es vor allem zwei Wege ins Berufsleben: Studium oder Ausbildung. Besonders auf das Thema Ausbildung wollen wir einen Fokus legen. Das System der dualen Ausbildung genießt in Deutschland (und teils auch international) ein hohes Ansehen, sowohl bei Ökonom*innen als auch Arbeitgeber*innen und Gewerkschaften. Doch das System hat auch strukturelle Schwächen, die seit Beginn der Coronapandemie besonders deutlich geworden sind.
2020 sind die Auszubildendenzahlen um 11% gesunken. Dass es „nur“ 11% waren, ist dabei wohl den zahlreichen staatlichen Maßnahmen zu verdanken, die ergriffen worden sind . Doch was ist, wenn diese Maßnahmen auslaufen? Eine Insolvenzwelle droht und könnte bis zu 25.000 Unternehmen betreffen. Nicht ausgenommen davon sind Unternehmen, die Staatshilfe erhalten haben. Und eine aktuelle Betriebsbefragung ergab, dass 10% der Betriebe aufgrund der Krise weniger oder gar keine Ausbildungsplätze mehr anbieten wollen. Im Juli gab es laut Bundesagentur für Arbeit in NRW 38.555 junge Menschen, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz waren. Hinzu kommt, dass Berufsorientierung und Ausbildungsvermittlung während der Pandemie nicht ausreichend stattgefunden hat, sodass Ausbildungsinteressierte und Unternehmen nicht zusammengefunden haben.
Der Berufsbildungsbericht 2021 zeigt zudem, dass junge Menschen mit Migrationsgeschichte überproportional häufig keinen geeigneten Ausbildungsplatz finden. Von den Bewerber*innen ohne Migrationsgeschichte waren 9% erfolglos und mussten sich arbeitslos melden. Hatten die Bewerber*innen eine Migrationsgeschichte, lag diese Quote bei 16%.
Dabei kommt dem Finden eines Ausbildungsplatzes eine hohe Bedeutung zu. Ohne Berufsqualifikation sinken die Chancen auf wirtschaftliche Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben massiv. So können gesamtgesellschaftliche Ungerechtigkeiten zementiert werden, wovon aber nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleich tangiert werden.
Die Aussichten sind also nicht gut. Wer allerdings einen Blick in den letzten Berufsbildungsbericht wirft, wird feststellen, dass es schon vor der Pandemie erhebliche Probleme gab: In Branchen mit guten Arbeitsbedingungen fehlen Ausbildungsplätze, in Branchen mit schlechten Arbeitsbedingungen gibt es offene Stellen, die viele Jugendliche aber zurecht nicht antreten wollen. Fachkräftemangel kann auch selbstverschuldet produziert werden.
Um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden, um zu ermöglichen, dass alle die Chance auf gute Arbeit haben, die zu den individuellen Vorstellungen eines guten Lebens passen und damit insbesondere das Ausbildungssystem besser gestaltet wird als heute, fordern wir:
- Eine bundesweite, umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie. NRW soll mit Modellprojekten vorangehen und überbetriebliche Ausbildungsstätten schaffen. Dort können Jugendliche eine vollqualifizierende Berufsausbildung machen, wenn sie auf dem regulären Arbeitsmarkt keinen geeigneten Ausbildungsplatz erhalten haben.
- Berufsschulen, die sich in baulich gutem Zustand befinden, gut ausgestattet sind und über genügend gut qualifizierte Lehrer*innen verfügen.
- Die Erweiterung und den flächendeckenden Ausbau von Berufsorientierungsangeboten, die junge Menschen da erreicht, wo sie sind und die digitaler und aufsuchender werden
- Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich und familienfreundlichere Arbeitszeitmodelle.
- Eine gerechtere Verteilung von unbezahlter Pflege- und Familienarbeit zwischen Männern und Frauen.
- Die Anpassung des Arbeits- und Sozialrechts an den digitalen Wandel und für klare Regeln beim Homeoffice.
- Die Förderung von Betriebsratsgründungen, die Stärkung der Rechte von Betriebsräten und Gewerkschaften sowie eine Ausweitung der betrieblichen und Unternehmens-Mitbestimmung
- Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Fördermitteln ausschließlich an Unternehmen, welche zu den Grundsätzen von Tariftreue und Mitbestimmung
- Weiterbildung zu stärken. Es muss ein Recht auf Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen geben. Zudem müssen die Hochschulen in NRW systematisch für beruflich Qualifizierte geöffnet und die berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote durch die NRW-Hochschulen ausgeweitet werden.
- Mitarbeiter*innen die Beteiligung am Unternehmenskapital zu fördern.
- Mehr Stellen beim Arbeitsschutz.
- Stärkung des sozialen Arbeitsmarkts, insbesondere über die Instrumente §16e und §16i des SGB II.
Sozial-ökologische Transformation als Erfolgsgeschichte
Sommerwetter im Februar und Mai, Schneechaos im April, Rheinhochwasser im Januar, eine Hitzewelle mit tropischen Temperaturen im Juni und die verheerenden Regentage im Juli, dazu immer wieder orkanartige Stürme und Unwetter. NRW hat 2021 ein Jahr der Wetterextreme erlebt. Weltweit steigt die Anzahl der Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen beinahe kontinuierlich an. Schon seit vielen Jahren wissen wir: Der menschengemachte Klimawandel verursacht diese Wetterextreme.
Als Land NRW haben wir in diesem Jahr vielleicht so klar wie noch nie gesehen, was es bedeutet, wenn wir unser Leben und unsere Wirtschaft nicht umstellen, wenn wir keine Rücksicht auf die Natur und die uns nachfolgenden Generationen nehmen. Es ist Zeit für einen echten Aufbruch!
2020 hat alleine NRW 203,5 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Bundesweit sind es 739 Millionen Tonnen an Treibhausgasen gewesen. Diese Zahlen zeigen die große Verantwortung unseres Bundeslandes. Für die Bilanz positiv war die schlechte wirtschaftliche Lage aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr. In diesem Jahr müssen wir wieder einen Anstieg der klimaschädlichen Gase fürchten.
Es gilt also unser Wirtschaften zu verändern. Sozial und ökologisch verträglich soll unser Land in Zukunft wirtschaften. Dazu braucht es massive Investitionen, um einen Umbau der Wirtschaft voranzutreiben. Die Energiewende muss einen neuen Anschub erfahren. Dabei wollen wir jedoch auch neue Arbeitsplätze schaffen. NRW muss einen weiteren Strukturwandel managen und kann sich ein Scheitern aufgrund einer Sparpolitik nicht leisten. Als Zukunftsland wollen wir innovative Projekte ermöglichen, die Digitalisierung voranbringen, klimaneutrale Produktion fördern und an der Zukunft forschen. Dafür braucht es jedoch einen starken Staat, der sich traut mitzureden. Ein Staat, der den Unternehmen einen Weg in eine saubere und soziale Zukunft weist. Unser Land darf nicht am Rand stehen, wenn Manager*innen und Aktionär*innen schlicht profitorientiert in die nächsten Jahrzehnte blicken, sondern muss unter der Bedingung von guter Arbeit und ressourcenschonendem Verbrauch von Rohstoffen aktiv den Markt steuern.
Die sozial-ökologische Transformation bietet Umweltschutz und ein besseres Morgen für uns alle. Ein derart wichtiges Zukunftsprojekt darf NRW nicht verschlafen. Konservative und liberale Kräfte werden niemals ein gesteigertes Interesse an den Aufgaben von Morgen haben, solange es im jetzt noch Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Kapitalismus gibt. Wohin uns das führt, haben wir in 2021 schmerzlich erfahren. Daher liegt es an uns, die Industrie in NRW so aufzustellen, auf dass Morgen ein besserer Tag sein wird.
Damit die sozial-ökologische Transformation eine Erfolgsgeschichte wird, fordern wir:
- einen Staat, der den Wandel aktiv gestaltet, indem er:
- ein Staatsverständnis zu Grunde hat, in dem er Marktprozesse aktiv steuert und auf gute Arbeit und geringen Ressourcenverbrauch Wert legt.
- eine starke industriepolitische Planung vorlegt, die Entwicklungsziele, technisch anspruchsvolle Benchmarks, Förderprogramme und Sanktionen beinhaltet.
- Grenzwerte, Grenzmengen und Technologieverbote bei umweltschädlichen Produkten festlegt.
- umweltschädliche Subventionen streicht und eine sozial ausgestaltete CO2-Bepreisung sichert.
- einen neuen Indikator zur wirtschaftlichen Steuerung entwickelt, der finanzielle, soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt.
- international für besseren Klimaschutz kämpft, da Treibhausgase nicht an nationalen Grenzen halt machen.
- das Pariser-Klimaabkommen ernst nimmt und sich in seinem Handeln an diesem immer orientiert.
- einen staatlichen Transformationsfonds zum sozial-ökologischen Umbau der Industrie in NRW, um:
- die Bereitschaft zur klimaneutralen Produktion im Land schnell zu fördern und durch zusätzliche Investitionen in Forschung der Industrie ein modernes Angebot zu machen.
- innovative Ideen nicht am Kapitalmangel oder fehlender Risikobereitschaft scheitern zu lassen.
- durch zeitlich begrenzte Unternehmensbeteiligungen des Landes an kleinen und mittleren Unternehmen diese taktisch zu stärken.
- in Beiräten zur Transformation vor Ort mit den Partner*innen aus der Gesellschaft und Kommunalpolitik den Wandel zu gestalten.
- Insbesondere Unternehmen zu fördern, die sozial verantwortlich arbeiten, da finanzielle Unterstützung künftig auch an derartige Aspekte geknüpft sein soll.
- eine solidarische Energiewende. Für uns bedeutet das:
- mehr Solaranlagen auf freien Flächen und den Ausbau von Windenergie.
- kein Versperren vor Windkraftanlagen, sondern intensiver Ausbau mit staatlicher Förderung, um den stockenden Ausbau anzutreiben. Pauschale Mindestabstände sind kontraproduktiv.
- den Ausbau von Fernwärme und die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung.
- den massiven Ausbau von Arbeitsplätzen für die erneuerbaren Energien bis 2030, um zukunftssichere und unserer Zeit entsprechende Arbeitsplätze für die Menschen in NRW zu schaffen.
- die umfangreiche, dezentrale und ökologische Produktion von grünem Wasserstoff in NRW, sowie die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur von Rohrleitungen zum Transport.
- Forschung an Speicherkapazitäten in NRW, um jederzeit Versorgungssicherheit garantieren zu können. Dabei müssen die Speichertechnologien, wie auch unser Energie-Mix, divers aufgestellt sein, um störungsunanfällig zu sein und die Vorteile verschiedener Speichertechnologien zu nutzen.
- erneuerbare Energien werden bis 2030 Grundlage unserer Stromversorgung.
- die Vernetzung und Förderung für die Energiewende relevanter Industrien.
- eine nationale Debatte zur gemeinsamen Gestaltung der Energiewende zu initiieren.
- aus Pilotprojekten landesweite Erfolgsmodelle zu gestalten.
- Vorbilder, wie die „Innovation City Bottrop“, in der ein ganzer Stadtteil klimagerecht umgebaut wird bei gleichzeitiger Sicherung des Industriestandortes, müssen Schule machen und im gesamten Land Nachahmer*innen finden.
- Die Finanzierung dieser Projekte muss jedoch überdacht werden, da diese einmaligen Situationen die städtischen Haushalte ansonsten auf Generationen massiv belasten.
- Zu beachten ist, dass wir keinen Wettbewerb zwischen den Kommunen schaffen, da Klimaschutz höhergestellt sein muss als jedweder Wettbewerbsgedanke und die Planungshoheit bei den Städten liegt. Das Land kann hier nur beraten.
- den Ausbau der Digitalisierung NRWs. Konkret bedeutet dies:
- eine flächendeckende Versorgung mit 5G in unserem Land; Investitionen in Glasfasernetze und Breitbandanschlüsse.
- den vermehrten Einsatz von open-source Lösungen, insbesondere in der Landesverwaltung.
- die IT-Sicherheit voran zutreiben, indem in NRW geforscht wird, wie wir unsere Daten und digitale Infrastruktur bestmöglich vor Angriffen und Unternehmen schützen.
- Den Aufbau von Strukturen, welche nachhaltig die Software-Branche im Allgemeinen und die boomende Gaming-Branche im Speziellen in NRW fördern und ausbauen. Diese unterstützen nicht nur finanziell – bei Gaming-Unternehmen ähnlich zur Filmförderung – sondern helfen auch bei der Ansiedlung und Neugründung von Software-Unternehmen in NRW.
- auch Mobilität als zwingenden Bestandteil der sozial-ökologischen Transformation zu begreifen und entsprechende Schritte einzuleiten. Diese lauten:
- Mobilität müssen wir als Grundrecht anerkennen, dass es braucht, damit ein jeder Mensch an der Gesellschaft teilnehmen kann.
- Bundesweit wollen wir bis 2030 das engmaschigste Mobilitätsangebot der Welt schaffen – in NRW beginnen wir damit! Dafür wollen wir sicherstellen, dass vom Thema Mobilität nicht nur die Ballungszentren profitieren, sondern auch der ländliche Raum zu jeder Zeit mitgedacht wird. Hier bedarf es eines dringenden Ausbaus. Dieser wird nur durch ungebremste Zukunftsinvestitionen ermöglicht.
- Der ÖPNV der Zukunft muss schnell Menschen von A nach B transportieren, fahrscheinlos, günstig – langfristig auch kostenfrei – sein, um eine ernsthafte Alternative zum Individualverkehr mit dem PKW Die Netze müssen dafür erweitert werden – sowohl in den Städten, als auch im ländlichen Raum.
- Neben dem ÖPNV müssen auch der SPNV und die Güterzugnetze ausgebaut werden. Mit massiven Investitionen schaffen wir ein neues Jahrzehnt der Schiene in NRW und verlagern so Güter- und Personenverkehr von den überfüllten Straßen, auf die neu gebauten Schienen. Getrennte Netze sollen künftig verbunden und stillgelegte Strecken wieder reaktiviert werden.
- Alle diese Maßnahmen werden in ländlichen Regionen auf absehbare Zeit dennoch den PKW nicht vollständig ersetzen können. Daher muss hier eine Umstellung von fossilen Antrieben hin zu Elektro, power-to-x und vor allem Wasserstoff erfolgen. Hier wollen wir, dass die Kommunen und Körperschaften öffentlichen Rechts voranschreiten und künftig ihre Fuhrparks auf H2-Antreib umstellen. In einem zweiten Schritt sollen staatliche Förderungen Wasserstofffahrzeuge auch für Privatpersonen unkompliziert ermöglichen.
- der jetzige Strukturwandel muss ein Erfolgsmodell für die betreffenden Orte werden. Dies schaffen wir, indem:
- die Flächen des rheinischen Tagebaurevier durch den Staat entwickelt werden. Dabei müssen soziale und ökologische Fragestellungen zusammengedacht werden, um weder die Kumpel ins Bergfreie fallen zu lassen, noch die Schäden an der Natur nicht zu beheben.
- keine erneute Monokultur in der Industrie entsteht.
- wir wirklich tragfähige Konzepte für die betroffenen Regionen zur Umstrukturierung der Wirtschaft entwickeln, die keine Deindustralisierung der Orte bedeutet.
Fazit
Mit diesem Antrag haben wir entlang der drei gesetzten Schwerpunkte unsere wichtigsten Forderungen an das Zukunftsprogramm der NRWSPD zur Landtagswahl aus Sicht der jungen Generation formuliert. Mit unseren Vorstellungen von Bildung für alle, wollen wir für Zukunftschancen von Beginn an sorgen. Mit klaren Forderungen für Gute Arbeit und Ausbildung geht es uns um Perspektiven für junge Menschen in der spannendsten Phase ihres Lebens, wenn es darum geht, selbstständig den Weg zu gehen, den man gehen möchte. Und mit einer sozial-ökologischen Transformation als Erfolgsgeschichte werden wir dafür sorgen, dass die ökologischen Grundlagen NRWs gewahrt bleiben und Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft ein starkes Industrieland ist, das die Energiewende meistert und Wohlstand garantiert.
Wir werden uns weiter intensiv in den Programmprozess der Partei einbringen und erwarten die Berücksichtigung unserer inhaltlichen Vorstellungen. Denn wir stehen bereit, gemeinsam mit unserer Mutterpartei dafür zu sorgen, dass im Westen wieder die Sonne aufgeht. Wir stehen bereit, die schwarz-gelbe Landesregierung, die sich vor allem mit der Darstellung von Politik beschäftigt und dabei Zukunftschancen für NRW verhindert, abzulösen. Und wir stehen bereit, dafür zu sorgen, dass eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung nach der Wahl endlich anpackt.