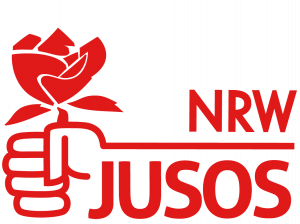Die Corona-Krise beeinträchtigt auch die psychische Gesundheit der Bürger*innen. Schon in nicht Krisenzeiten ist diese aber ein Tabuthema. So schätzen Expert*innen, dass nur etwa ein Drittel der in Deutschland an Depressionen leidenden Menschen ärztliche Unterstützung bekommen [1], was auch an Stigmatisierung und Unwissen liegt. Die Corona-Krise hat viele Menschen in unterschiedliche Extremsituationen gebracht, zu Traumata geführt oder diese verschlimmert. Dazu gehören Angstzustände, Isolation und Vereinsamung, häusliche und sexualisierte Gewalt oder Existenzangst. Aber auch die Erfahrung, Verwandte allein sterben lassen zu müssen oder im Kreissaal alleine gebären müssen, können nachhaltig Spuren hinterlassen. Eltern, die Job und Kinderbetreuung gleichzeitig bewältigen mussten, berichten von Überforderung mit teilweise gewalttätigen Folgen. Vor allem junge Menschen sind von der Krise finanziell betroffen [2] und Leiter*innen von Tafeln erzählen von einer „neuen Form der Not“ [3] und von jungen Menschen, die zur Tafel gegangen sind, weil sie sonst nichts mehr zu Essen gehabt hätten. Auch Kinder hat die Krise besonders getroffen: Sie konnten nicht mit anderen Kindern zur Schule gehen oder spielen – die sozialen Folgen der Schulschließungen können bis jetzt nur erahnt werden. Es ist auch nicht zu übersehen, dass Frauen einen übergroßen Teil dieser Last getragen haben und dass die Krise sich in Abhängigkeit der sozioökonomischen Lage von Personen unterschiedlich niedergeschlagen hat. Da die Krise weiterhin anhält, ist nicht davon auszugehen, dass sich diese Beschreibung der Lage schnell verändern wird.
Während den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen von der Politik mit dem größten Hilfspaket in der deutschen Geschichte begegnet wurde, sind die gesundheitlichen Folgen – sowohl physisch für die an Corona Genesenen als auch psychisch für alle Teile der Gesellschaft – bis jetzt weitestgehend untergegangen. Dadurch wird das Tabu, das es rund um psychische Gesundheit gibt, nur verstärkt. Dabei müssen viele Menschen extreme Situationen aushalten, was nicht spurlos vorbeigehen wird. Die ersten Ärzte bemerken die Folgen: „Eine Mehrheit der Pädiater spricht von einer Zunahme psychischer Störungen bei jungen Patienten infolge der Corona-Einschränkungen. 68 Prozent rechnen mit coronabedingten Traumata bei Heranwachsenden.“ [4] Beachtet werden muss auch die Lage der Therapeut*innen, die unter enorm erschwerten Bedingungen arbeiten müssen. Zudem sind durch Ausfälle von Sitzungen ambulante Praxen auch in finanzielle Not geraten. Ihre Arbeit muss anerkannt und finanzielle Hilfen angeboten werden, damit keine Praxen wegbrechen.
Wir fordern daher, dass auf unterschiedlichen Ebenen das Thema psychische Gesundheit nach Corona möglichst breit angegangen wird:
- Einrichtung von runden Tischen für psychische Gesundheit in den Kommunen, zu denen unter anderem die Vertreter*innen der Psychotherapeuten- und Ärztekammer, der DPtV (Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung) sowie Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Jugendämter eingeladen werden.
- Bereitstellung von Fonds für die Erforschung der Auswirkungen der Corona-Krise auf die psychische Gesundheit durch das Bundesministerium für Gesundheit.
- Unterstützung bei der Einrichtung von Selbsthilfegruppen zu den Folgen von Corona.
- Ausbau des Angebotes an Psychotherapie. Dabei muss beachtet werden, welche Aspekte in der Ausbildung junge Menschen darin hindern, diesen Beruf zu ergreifen sowie die Vergabe der Praxissitze überarbeitet werden.
- Professionelle Beratung von Lehrkräften, um Auswirkungen schnell zu erkennen.
- Aufstockung der Stellen in der Schulpsychologie durch die Länder, um ein besseres Angebot und eine bessere Betreuungsquote zu erreichen.
- Arbeitgeber*innen sind für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter*innen verantwortlich. Daher müssen sie zur betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) gesetzlich verpflichtet und hier bei Bedarf gleichermaßen gefördert bzw. befähigt werden. Nicht nur unter physischen Aspekten (z.B. Fitness), wie es schon weit verbreitet ist, sondern auch gleichermaßen unter psychologischen Aspekten. Das muss gleichermaßen für Arbeitnehmer*innen im Homeoffice gelten, da u.a. die soziale Isolation psychische Risiken mit sich bringen kann.
[1] https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/106418/Depression-noch-immer-Tabuthema (zuletzt aufgerufen am 03.07.2020)
[2] https://www.ksta.de/wirtschaft/studie-vor-allem-juengere-leiden-wirtschaftlich-unter-der-corona-krise-37121282 ((zuletzt aufgerufen am 06.08.2020)
[3] https://www.rnd.de/politik/corona-viele-junge-menschen-suchen-in-krise-hilfe-bei-tafeln-KDZZFJQ57ES2CZRUGJQHQNRTF4.html (zuletzt aufgerufen am 06.08.2020)
[4] https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/115323/Kinder-und-Jugendaerzte-warnen-vor-erneuten-Schulschliessungen?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter (zuletzt aufgerufen am 06.08.2020)