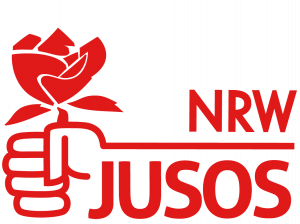Die politische Debatte im Jahr 2019 ist geprägt von der Klima-Frage. Nach dem Hitze- und Dürresommer 2018, den Bildern von schmelzenden Eisbergen und vermüllten Meeren in den Nachrichten und dem vor allem von jungen Menschen auf die Straße gebrachten Druck erwarten viele Menschen von der Politik ein schnelleres Umstellen auf eine nachhaltigere Wirtschafts- und Lebensweise. Der Klimawandel stellt in seinem Voranschreiten einen Imperativ für die Politik dar, der sich nicht wegverhandeln lässt: Wenn die Menschheit auf diesem Planeten eine Zukunft haben will, muss sie umsteuern. Wir als Jusos unterstützen deshalb die Bewegung Fridays for Future.
Gleichzeitig zeigt das Ergebnis der Europawahl aber auch, dass es offensichtlich nicht überall Klima-Fragen sind, die Menschen umtreiben. So sind es im Osten nicht nur die Grünen, sondern die Rechtsradikalen, die zulegen konnten. Wir stellen deshalb fest, dass wir es derzeit mit drei großen gesellschaftlichen Veränderungen zu tun haben: Erstens die ökologische Transformation, also der mit der Rio-Konferenz 1992 gestartete politische gesteuerte Versuch, die Wirtschafts- und Lebensweise der Menschen so umzustellen, dass der menschengemachte Klimawandel entweder aufgehalten oder zumindest eingeschränkt werden kann. Zweitens die Globalisierung, also die internationale Verflechtung von Wirtschaft und Gesellschaft. Und drittens die Digitalisierung, also die Automatisierung von Arbeitsprozessen. All diese Prozesse finden statt unter den Bedingungen eines sich in den vergangenen Jahrzehnten neoliberalisierten Kapitalismus.
Unser Ziel bleibt der demokratische Sozialismus, die Gesellschaft der Freien und Gleichen. In der Tradition der Arbeiter*innenbewegung sehen wir uns als progressive Partei, die den Fortschritt nicht verteufelt, sondern ihn gestaltet. Man kann die ökologische Frage nicht ohne die soziale Frage diskutieren – genauso wie man die soziale Frage nicht ohne ökologische Frage diskutieren kann. Die ökologische Krise macht klar: Unsere Wirtschaft kann nicht so weiter wachsen wie bisher. Trotzdem müssen wir an den Zielen des sozialen Fortschritts festhalten. Statt einer „Zurück in die Höhle“-Politik stehen wir für nachhaltiges Wachstum, das soziales und grünes Wachstum miteinander verbindet.
Kernthema sozialdemokratischer Politik muss wieder Wirtschaftspolitik werden. Nicht das, was in den vergangenen Jahrzehnten oft missverständlich als Wirtschaftspolitik bezeichnet worden ist, nämlich die Liberalisierung von Märkten, sondern eine wirkliche Politisierung und damit Demokratisierung der Wirtschaft. Die Neoliberalisierung der Politik hat dazu geführt, dass der Staat und damit die demokratische Kontrolle sich zunehmend aus Wirtschaftsfragen zurückgezogen, sich den Marktimperativen unterworfen und damit die Zunahme sozialer Ungleichheit in Kauf genommen hat. Das ist nicht nur eine Gefahr für die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, sondern auch für die Demokratie: Wenn Netflix das Stadttheater, Amazon die Stadtbücherei, der private Konzern das kommunale Krankenhaus und Uber das Taxi ersetzt, geraten nicht nur die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten unter Druck, sondern dann verlieren auch die Menschen demokratische Kontroll- und Mitbestimmungsmöglichkeiten und überlassen sie den großen Konzernen.
Dazu kommt für die mittelstandsbasierte europäische Wirtschaft eine globale Bedrohung: Der Wettbewerb mit den amerikanischen Tech-Konzernen und den chinesischen Staatsunternehmen ist längst Realität und die Politik bleibt sprachlos, wie sie Wettbewerbsfähigkeit ohne ein Herabsenken von Arbeitsbedingungen und sozialen und ökologischen Standards garantieren kann.
Stattdessen setzt gerade die Europäische Kommission auf eine hoch schädliche Wettbewerbspolitik, die arbeitsplatzsichernde und globale Wettbewerbsfähigkeit schaffende Fusionen mittelgroßer und großer Unternehmen blockiert. Prominentes Beispiel ist die Blockade der Fusion von Thyssenkrupp mit Tata Steel. Bei der geplanten Fusion wurde unter Beteiligung der IG Metall ein langjähriger Ausschluss von Kündigungen vereinbart. Nach dem Stopp der Fusion baut Thyssenkrupp nun Stellen ab.
In Anbetracht der globalen und digitalen Veränderungen und der ökologischen Herausforderung lohnt es sich einen Blick auf einen Sektor der Wirtschaft zu werfen, der vielen schon als Relikt der Vergangenheit galt: Die Industrie. Erst durch die große Finanzkrise, in der mit dem Finanz- und Bankensektor einer der wichtigsten Dienstleistungssektoren in eine tiefe Krise geriet, wurde der Wert einer starken und zukunftsfähigen Industrie wiederentdeckt. Wir wollen deshalb an dieser Stelle Grundsätze aufstellen, wie jungsozialistische Industriepolitik in Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel aussehen kann.
Nachhaltig wachsen – ein rotes Konzept
Grünes Wachstum ist eine rote Idee! Heute muss es darum gehen, grünes und soziales Wachstum zu nachhaltigem Wachstum zu verbinden.
Die Kritik am kapitalistischen Wachstum ist für die Arbeiter*innenbewegung ein historisch gewachsenes Kernanliegen. In der Tradition des Demokratischen Sozialismus fiel das Urteil über Wachstum als Produktion von gesellschaftlichem Mehrwert meist ambivalent aus: Einerseits folgte aus der Industrialisierung nach kapitalistischer Logik, dass hiermit Massenarmut und Entfremdung des Menschen einhergingen, wie es Karl Marx und Friedrich Engels herausgearbeitet haben. Andererseits ist der Kapitalismus gerade aus marxistischer Sicht ein Gesellschaftssystem von zuvor nicht gekannter Leistungsfähigkeit. Seine Produktivkräfte konnten den Feudalismus zerstören und vorher unvorstellbaren gesellschaftlichen Reichtum erzeugen, der sich allerdings auf die herrschende bürgerliche Klasse konzentrierte. Marx und Engels prophezeiten, dass sich der Kapitalismus früher oder später selbst überwinden würde, weil er Produktivkräfte (wie Maschinen, Technik) hervorbrächte, die seine Logik sprengten. Im Vertrauen auf diesen „großen Kladderadatsch“ setzte die deutsche Sozialdemokratie mit ihren Gewerkschaften im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert auf eine Doppelstrategie: Zum einen wollte sie die konkreten Problemlagen der ausgegrenzten Arbeiter*innen nicht ignorieren. Zum anderen hielt sie mehrheitlich große ‚reformistische’ Systemveränderungen für unmöglich. Der Druck auf diese Doppelstrategie wuchs nach der Novemberrevolution 1918 gewaltig an: Die Sozialdemokratie stand auf der einen Seite im Kampf gegen reaktionäre Monarchist*innen und Nationalist*innen und auf der anderen in Konkurrenz zu den zunehmend fremdgesteuerten Kommunist*innen. In dieser Lage mussten die Sozialdemokrat*innen die neuen demokratischen Errungenschaften verteidigen. Die Kritik am System trat realpolitisch zurück, auch wenn sie in der Sozialdemokratie ideologische Bedeutung hatte. Sozialer Fortschritt innerhalb einer kapitalistischen Wirtschaft – das erschien jetzt machbar, zumindest für die vielen Sozialdemokrat*innen, die in Reichs- oder Landesregierungen, aber auch in Betriebsräten und Gewerkschaften Ämter inne hatten. Schon zu Zeiten der Weimarer Republik hatten sich also innerhalb der sozialdemokratischen Praxis die Schlussfolgerungen verändert, die aus der marxistischen Kapitalismuskritik gezogen wurden. Auch wenn der Kapitalismus noch immer mit Argwohn betrachtet wurde, so erschien er nicht mehr in erster Linie als unabdingbar ausbeuterisches System, das sich bald selbst überwinden würde. Stattdessen packte die Sozialdemokratie die fortschrittliche Seite des Kapitalismus beim Schopfe: Sie sah dessen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und versuchte, das kapitalistische Grundübel – wonach der Mehrwert der Produktion den Kapitalist*innen zugeführt wird – durch Reformen in den Griff zu bekommen. Es ging ihnen einerseits um betriebliche Beteiligung der Arbeiter*innen am erzeugten Mehrwert, andererseits um den Ausbau des bisher Bismarckschen Sozialstaats. Dieser schon lange praktizierte Ansatz wurde in Bad Godesberg 1959 auch zum Programm der SPD. Kapitalistisches Wirtschaftswachstum galt jetzt als potenzielle Quelle von sozialem Fortschritt, wenn denn der Mehrwert der Produktion betrieblich und gesellschaftlich mit der Arbeiter*innenschaft fair geteilt würde. Das Credo war: Kapitalistisches Wachstum muss als soziales Wachstum verwirklicht werden. Dieses Wachstumsverständnis ist in der Sozialdemokratie bis heute sehr präsent, doch erfährt es spätestens seit Mitte der 70er Jahre gut begründeten Widerspruch.
Ab 1966 stand die SPD in der Bundesrepublik erstmals in Regierungsverantwortung. In Abgrenzung zu der marktorientierten Zeit des Wirtschaftswunders setzte man konzeptionell auf klare Gegenmodelle für neues Wachstum. Politische Planung der Gesellschaft und besonders Karl Schillers Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sollten neuen Fortschritt bringen. Diese neuen Konzepte setzten auf die Chancen aufkommender (Computer-)Technologie und die Umsetzung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Auf dieser Grundlage, so dachten damals nicht nur Sozialdemokrat*innen, ließe sich die Wirklichkeit besser analysieren und verändern. Durchaus mechanisch gedacht sollten politische Ziele schlichtweg „von oben“ durchgeplant und umgesetzt werden (z.B. beim Ziel der Vollbeschäftigung). Bei diesen hochgesteckten Zielen blieb der Erfolg der Planungseuphorie aus. Das Scheitern von Bretton Woods, die Ölkrise, die enttäuschten Menschen, die sich von Willy Brandts „Wir wollen mehr Demokratie wagen“ fälschlicherweise eine direkt demokratische statt repräsentativ demokratische Stärkung erhofft hatten und dann mit einer Politik konfrontiert wurden, die planerisch von oben soziales Wachstum durchsetzen wollte: Die Hochphase des Keynesianismus scheiterte und wurde durch neoliberale Wirtschaftspolitik ersetzt, die mehr Effizienz und mehr Freiheit versprach.
In der gleichen Zeit nahm eine zweite Entwicklung ihren Anfang: 1972 wurde die schon heute klassische Studie „Die Grenzen des Wachstums“ vom Club of Rome veröffentlicht. In aller Schärfe wandte sich die Studie gegen das Wirtschaftswachstum, von dem bisher v.a. die Industrieländer profitiert hatten. Die Studie rechnete hypothetisch vor, dass viele der benötigten Ressourcen (wie seltene Metalle etc.) schon in wenigen Jahrzehnten aufgebraucht wären. Der Tenor war klar: Auf einem materiell begrenzten Planeten könnte es kein unbegrenztes Wachstum geben. Eine weitere desaströse Folge von Industrialisierung und Kapitalismus wurde damit beleuchtet: Wirtschaftliches Wachstum zerstörte zunehmend seine eigene ökologische Grundlage. Schon Marx hatte davon gesprochen, dass der Kapitalismus eine Tendenz hat, seine eigene Grundlage zu zerstören: Arbeiter*in und Boden. Die daraus entstandene Bewegung fand ihren Weg in die Sozialdemokratie: Gerade die Jusos waren stark in die Anti-AKW-Proteste involviert. Allerdings ist es zweifelsohne ein politisches Versäumnis der Sozialdemokratie, dass trotz aller Bemühungen einiger Sozialdemokrat*innen wie etwa Erhard Eppler weder Kanzler Schmidt noch Parteivorsitzender Willy Brandt ein glaubwürdiges Angebot an die neue ökologische Bewegung richten konnte. War bis in die 70er Jahre die Friedens- und Ökologiebewegung rein sozialdemokratisch, bekam die SPD zu Beginn der 80er Jahre mit der Gründung der Grünen eine Konkurrenz. Konzeptionell blieb die ökologische Bewegung zunächst blank. Die ersten Ansätze, die über ein „Zurück in die Höhle“-Konzept hinausgingen, waren Ende der 80er Jahre sozialdemokratische Ideen zu grünem Wachstum mit dem Ziel, die Produktion von gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Mehrwert vom Verbrauch endlicher Ressourcen abzukoppeln.
1991 war es der Sozialdemokrat Hermann Scheer, der das erste Einspeisevergütungsgesetz für Erneuerbare Energien erarbeitete und es zu einem überparteilichen Beschluss brachte. Zehn Jahre später folgte das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das inzwischen die Strukturen der Stromerzeugung grundlegend geändert hat. 2018 lag der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor in Deutschland bei 38 Prozent. Die Treibhausgasemissionen konnten seit 1990 um fast 30 Prozent gesenkt werden. Alleine die Chemie-Industrie hat den Ausstoß von Schadstoffen seit 1990 halbiert. Auch wenn nach aktuellem Stand die Anstrengungen nicht ausreichen werden, um die von der Bundesregierung gesteckten Ziele (40 Prozent Minderung der Treibhausgase bis 2020 gegenüber 1990, 55 Prozent bis 2030, 70 Prozent bis 2040 und Treibhaus-Neutralität bis 2050) zu erreichen, so zeigt sich grundsätzlich: Wachstum und Nachhaltigkeit sind keine Widersprüche.
Gerade wenn es um Arbeitsplätze und Strukturwandel in alten Industrie-Regionen geht, kann aber ein Zielkonflikt zwischen grünem und sozialem Wachstum bestehen. Richtige soziale Ziele und notwendige ökologische Transformation dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Deshalb gilt es grünes und soziales Wachstum zu nachhaltigem Wachstum zu vereinen. Dieses Wachstum ist ein Gegenmodell zum Wachstum des neoliberalisierten Kapitalismus: In eine gute Zukunft für alle wachsen statt kurzfristig den größtmöglichen shareholder value zu erzeugen.
Klimapolitik heißt Umverteilungspolitik
Heute werden Klimafragen wieder intensiv diskutiert und kaum jemand rechnet der SPD Kompetenzen in diesem Bereich zu. Offensichtlich hat die Partei es in den vergangenen Jahren versäumt, ein eigenes Verständnis davon zu entwickeln, was in der heutigen Zeit Klimapolitik aus sozialdemokratischer Perspektive heißt. Und so gibt es derzeit ein hegemoniales Verständnis von Klimapolitik, das auf Verbote und Regulationen setzt, die soziale Frage aber vollkommen ausklammert.
Diese Verbots-Ausrichtung wird von Rechten und teilweise von Liberalen angegriffen, erstaunlicherweise aber kaum von links kritisch hinterfragt. Unsere Gesellschaft ist geprägt durch ein soziales Auseinanderdriften. Eine einseitige Ausrichtung auf Verbots-Politik wird dazu führen, dass Klimapolitik den Spaltkeil in die Gesellschaft noch tiefer treibt.
Klimapolitik, die auf nachhaltiges Wachstum setzt, muss als Umverteilungspolitik verstanden werden. Das heißt in erster Linie ein aktiver Staat, der gerecht besteuert, um nachhaltige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit zu finanzieren. So kann Klimapolitik auch als Mittel verstanden werden, einen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft zu leisten.
Zukunftsfähige Industrie gibt es nur mit strategischer Industriepolitik
Das Ende der Industrie als wichtiger Sektor zukunftsfähiger Wirtschaft galt schon als breiter Konsens. Von Liberalen über Konservative bis hin in breite Teile der Sozialdemokratie erwartete man im 21. Jahrhundert ein Zeitalter der Dienstleistungen und Finanzmärkte. Diese Euphorie zerplatzte in der Finanzkrise. Deutschland, lange als kranker Mann Europas verspottet, konnte davon profitieren, dass es noch immer einen hohen Anteil von Industrie und industrienahen Dienstleistungen an der Wertschöpfung hatte. Die noch starke Industrie zusammen mit dem Konjunkturprogramm, das die SPD in der großen Koalition gegen die ideenlosen Unionsparteien durchsetzen konnte, führten dazu, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten glimpflich aus der Weltwirtschaftskrise kam. Doch dass der Wert der Industrie wieder erkannt worden ist, führt alleine noch nicht dazu, dass Industriepolitik strategisch betrieben wird, um sie auf das Ziel des nachhaltigen Wachstums auszurichten.
Derzeit ist die Industriepolitik von zwei gegensätzlichen Ansätzen geprägt. Zum einen gibt es den klassisch neoliberalen Ansatz, nach dem der Staat lediglich Bürokratie abbaut und ansonsten auf die Innovationskraft des Marktes hofft. Dieser Ansatz übersieht, dass private Investoren oft das Risiko scheuen, das für die notwendige Innovation notwendig wäre. Von der Eisenbahn über Internet, GPS, Touchscreens bis hin zu moderner Nanotechnologie sind die wesentlichen zu Wachstum führenden Innovationen durch die Risikobereitschaft des Staates entstanden. Der Kapitalismus hingegen hat sich in eine Richtung entwickelt, in der Wertabschöpfung stärker belohnt wird als Wertschöpfung. So wird zugelassen, dass vor allem die großen Digital-Konzerne von den staatlichen Investitionen profitieren, gleichzeitig aber keinen angemessenen Beitrag als Steuern zurückzahlen müssen. Lenkt man gegen diese Entwicklung nicht ein, gerät die für nachhaltiges Wachstum notwendige Innovationsfähigkeit in Gefahr. Der neoliberale Ansatz ist also nicht zukunftsfähig.
Auf einen gegensätzlichen Ansatz setzt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Als Antwort auf den Druck, der durch die Wettbewerbsvorteile chinesischer und amerikanischer Konkurrenz entsteht, will er bestehende Industrien durch wirtschaftspolitisch flankierte Modernisierung erhalten, also in erster Linie nationale Champions zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit fördern, etwa durch Lockerungen von Fusionsregeln. Das klingt auf den ersten Blick nachvollziehbar und kann bei Einbindung von Gewerkschaften und bei einer klaren Prioritätensetzung auf den Erhalt von Arbeitsplätzen und Tarifbindung dabei helfen, die Rechte von Beschäftigten zu erhalten und auszubauen. Langfristig hilft dieser Ansatz aber zur Schaffung von nachhaltigem Wachstum auch nicht weiter. Denn was die zukunfts- und marktfähigen Sektoren und Technologien sind, kann nicht der Staat vorschreiben. So könnten Ressourcen an den falschen Stellen eingesetzt und vergeudet werden. Letztlich verhindert dieser Ansatz mehr Innovation als dass es sie schafft.
Weder der neoliberale noch der staatsmonopolistisch-kapitalistische Ansatz von Peter Altmaier sind strategische Industriepolitik. Ziel muss es sein, Innovation zu schaffen, die zu nachhaltigem Wachstum führt. Kernvoraussetzung dafür ist ein aktiver Staat, der zu Investitionen bereit ist. Die Schuldenbremse in der Verfassung und die schwarze Null als erklärtes politisches Ziel wirken sich faktisch als Investitionsbremse aus.
Für eine strategische Industriepolitik gilt es, sowohl Angebot als auch Nachfrage in den Blick zu nehmen. Wenn man mit Blick auf die derzeitigen Herausforderungen die Angebotsbedingungen positiv gestalten will, hilft es nur wenig, über Senkungen von Steuern und Abbau von Bürokratie zu reden. Stattdessen muss Angebotspolitik als Investitionspolitik begriffen werden: Anders als etwa Bundesbildungsministerin Anja Karliczek es sich vorstellt („Kein 5G an jeder Milchkanne“) muss der Staat eine flächendeckende und anspruchsvolle digitale Infrastruktur anbieten. Außerdem gilt es mit risikobereiter staatlicher Grundlagenforschung die Voraussetzungen für wirtschaftliche Innovationen zu schaffen. Gleichzeitig muss der Staat über öffentliche Nachfrage dazu beitragen, nachhaltige Produktivität zu ermöglichen. Dafür müssen ökologische Produktionsprozesse industrialisiert werden. Ziel der strategischen Nachfrage-Politik muss also die Etablierung einer Massenproduktion ökologischer und sozialer Güter sein.
Gute Arbeit ist die Voraussetzung für eine gute Wirtschaft
Digitalisierung, Globalisierung und ökologische Transformation bedeuten auch eine Veränderung der Arbeitswelt. Aus der Geschichte der Arbeiter*innenbewegung wissen wir, dass Arbeit im Zentrum aller gesellschaftlichen Entwicklung steht. Noch immer gibt es die weit verbreitete Auffassung, die auch der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber im Europa-Wahlkampf wiederholte: „Sozial ist, was Arbeit schafft.“ Übersetzt also: Die Aufgabe von Politik sei es nur, Arbeitsplätze zu schaffen, die Bedingungen der Arbeit aber dem freien Spiel der Märkte zu überlassen. Dabei ist auch klar: Würden ökologische Verbesserungen zu einer Verschlechterung von Arbeitsbedingungen führen, würde dies zu berechtigtem Widerstand gegen die ökologische Transformation führen.
Wenn nachhaltige Industriepolitik wirklich grüne und soziale Ziele miteinander verbinden soll, muss sie auch für gute Arbeitsplätze und eine Stärkung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Teilhabe sorgen. Das Ziel muss deshalb emanzipative Vollbeschäftigung (auch unter Berücksichtigung von zum Beispiel Care-Arbeit) heißen und kann nicht über Konzepte des Bedingungslosen Grundeinkommens erreicht werden. Gerade in Zeiten des Wandels ist es stattdessen wichtig, betriebliche Mitbestimmung und Tarifbindung zu stärken.
Die Bereitstellung von guten Arbeitsplätzen wird vor allem in den Regionen relevant, die besonders vom Strukturwandel betroffen sind. Ein Ansatz ist es, speziell Forschungsgelder in diese Regionen fließen zu lassen um mit dem Bau oder Ausbau von Hochschulen und Forschungseinrichtungen neue Impulse für die Regionen zu geben. Wichtig wird es auch sein, in diesen Regionen nicht nur zu forschen, sondern auch die Innovationskraft in den Betrieben zu stärken. Viele mittelständische Betriebe haben zum Beispiel nur wenige oder gar keine Ingenieur*innen, sodass die Digitalisierung gerade für diese Betriebe, die vielen Menschen Arbeit geben, eine besonders große Herausforderung wird. Deshalb sollte in diesen Regionen nicht nur geforscht, sondern auch Technologietransfer organisiert werden. Als Beispiel könnte dafür könnte das Technologie-Netzwerk aus Ostwestfalen-Lippe „it’s owl“ herangezogen werden. Kommunale und regionale Wirtschaftsförderung muss dazu Prozesse moderieren, die die Abhängigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen von zum Beispiel der Autoindustrie zu mindern und Produktvielfalt fördern. Dazu kommt, dass mit Blick auf die oft schlechten Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft eine einseitige Fokussierung auf Forschungseinrichtungen nicht ausreicht. Ziel muss es sein, auch in diesen Regionen neue Industrien mit guten Arbeitsplätzen anzubieten.
Deindustrialisierung spaltet die Gesellschaft
Die industrielle Arbeiter*innenschaft hat durch eine starke gewerkschaftliche Organisationsquote hohe Tariflohnabschlüsse erkämpft und Anschluss an die Mittelschicht der Angestellten gefunden. Diese Entwicklung kann auch als „Ende des Proletariats“ beschrieben werden und findet Ausdruck in der These, dass sich die „Sozialdemokratie zu Tode gesiegt“ habe. Eine trügerische Einschätzung, denn der eigentliche Bruch in dieser neuen industriellen Mittelschicht hatte schon mit den ersten Zechenschließungen Ende der 50er Jahre in Ostwestfalen eingesetzt. Das Zechensterben war dabei nur das markanteste Beispiel für eine Entwicklung, die vom Verschwinden industrieller Arbeitsplätze geprägt war. Selten wurde es dabei so laut wie bei den Protesten zwischen Rhein und Ruhr, aber die Deindustrialisierung erfolgte stetig, lautlos und dauerhaft. War 1970 noch jeder zweite Arbeitsplatz in Deutschland im industriellen Sektor angesiedelt, war es in den 1990er Jahren nicht mal mehr jeder dritte.
Neben der Tatsache, dass technologische Entwicklungen zu einem Abbau von Arbeitsplätzen geführt hat und in der Spitze bedeutet, dass ganze Produktionsketten automatisch ablaufen und noch durch eine Maschienenbediener*in kontrolliert werden, hat auch die neoliberale Hochphase zu einem Umdenken in der Unternehmensführung geführt. Zum einen ist Shareholder-Value-Prinzip ist schon Ende der 80er Jahre zum betriebswirtschaftlichen Einmaleins geworden und damit die Macht von Betriebsräten und Gewerkschaften Stück für Stück aus den Unternehmen verschwunden. Zum anderen haben Digitalisierungs- und Outsourcingprozesse zu einer Optimierung von Produktionsabläufen geführt, die in den meisten Fällen einfache Arbeitsabläufe ins günstigere Ausland verlagerten. Die deutsche Arbeitnehmer*innenschaft wurde Stück für Stück spezialisiert bis zu dem Punkt, an dem eine ganze Produktionsbranche wegbrach und diese Spezialist*innen nicht mehr gebraucht wurden. Weil vor allem große Industrieunternehmen nicht die notwendige Flexibilität mitbrachten, traf diese Entwicklung das europäische Ausland deutlich härter als Deutschland, dessen industrieller Sektor vor allem durch mittelständischen Werkzeug- und Maschinenbau geprägt ist. So ist beispielsweise die englische Textilindustrie inzwischen fast völlig verschwunden.
Doch auch in Deutschland hat sich durch einen neuen Finanzmarkkapitalismus das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit noch einmal völlig neu definiert. Die Gewinne werden nicht mehr durch die eigentliche Produktion, sondern durch Börsenwetten generiert. Natürlich sind Teile der ehemaligen Industriebelegschaften auch im Dienstleistungssektor untergekommen. Gerade dort ist aber der gewerkschaftliche Organisationsgrad deutlich geringer und so ist ein Wechsel oft mit sozialem Abstieg verbunden. Außerdem sind öffentlicher Dienst und Dienstleistungssektor nicht im gleichen Maße gewachsen, wie der industrielle Sektor geschrumpft ist. Dieser Weg war also nicht für jede*n möglich. Wer im letzten Drittel des Erwerbslebens steht, kann keine langjährigen Umschulungsprozesse durchlaufen.
Im Zusammenspiel mit der Neuordnung der Sozialgesetzgebung unter dem Schlagwort Agenda2010 entwickelt sich so eine Art Teufelskreis. Menschen, die irgendwann ihre Arbeitsstelle verloren und mit Anfang Fünfzig nicht zurück in den Arbeitsmarkt gefunden haben, finden nicht zurück ins Erwerbsleben. Nach zwei Jahren Arbeitslosengeld I sind sie dann ganz unten angekommen: Auf „Hartz IV“. Als Folge müssen sie ihre Ersparnisse oder ihr Eigenheim aufgeben und stehen auf einer sozialen Stufe mit denjenigen, die noch nie gearbeitet hatten. Die hart erkämpften Erfolge von dreißig Jahren Erwerbsbiografie, auf die sie stolz waren, sind quasi aus dem Lebenslauf gestrichen worden. Das ist menschlich hart, demotivierend und es nimmt den Menschen ihr soziales Selbstverständnis.
Daneben trifft diese Entwicklung auch ungelernte Arbeiter*innen und Migrant*innen im besonderen Maße, weil diese beiden Gruppen oft auch prekäre Bildungsvorrausetzungen in einem selektiven deutschen Schulsystem haben. Für diese Gruppen gab es in den letzten Jahren keine „gute konjunkturelle Lage in Deutschland“. Der Gini-Koeffizient, der Vermögensverteilungen misst, hat sich laut OECD in den letzten zwanzig Jahren immer weiter erhöht. Das bedeutet vereinfacht gesagt: Große Teile der Gesellschaft partizipieren nicht am Wohlstand.
Gerade in den neuen Bundesländern ist diese Entwicklung besonders stark zu beobachten. Die staatlichen Großunternehmen der DDR sind nach der Wende im rasanten Tempo zerschlagen und privatisiert worden. Von den 150 Großbetrieben in der DDR mit mehr als 5000 Beschäftigten blieben nach der Wende noch fünf. Die Erfahrungen und Enttäuschungen, die die Menschen dort gemacht haben, wissen (neben anderen politischen Fehlentwicklungen wie etwa den fehlenden Konsequenzen für gewaltbereite Neonazis in den 1990er-Jahren) rechtsradikale Kräfte in Stimmenpotenzial umzusetzen. Ähnliche Entwicklungen lassen sich in den USA und Großbritannien beobachten: Es waren gerade die Regionen mit einer früher starken Industrie, deren Strukturwandel als politische Antwort der neoliberalen Politiken die Leitlinie „Das soll der Markt richten“ hatte, in denen viele Menschen gegen ihre eigentlichen ökonomischen Interessen für Trump oder für den Brexit gestimmt haben. Diese Stimmen sind auch ein Protest gegen eine linke Politik, die sich auf identitätspolitische Fragen konzentriert, die Spaltung der Gesellschaft durch die Deindustrialisierung aber für kaum relevant gehalten hat. Aber gerade der Teil der politischen Linken, der die Klassengesellschaft für überwunden gehalten hat, hat die Menschen verloren, die das Vorhandensein von Klassen mit unterschiedlichen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verwirklichungschancen jeden Tag in ihrem Alltag zu spüren bekommen. Diese Spaltung zwischen Zentrum und Peripherie ist wohl nirgendwo so eindrucksvoll zu beobachten wie in den USA: Küstenregionen mit nahmen Zugriff zu politischer, wirtschaftlicher und medialer Macht und dazwischen deindustrialisierte Regionen, die im Volksmund als „flyover states“ verspottet werden, weil die Mächtigen und Reichen sie nur vom Blick aus dem Flugzeug kennen. Wo eine politische Linke mit der Beantwortung sozialer Fragen und dem Versprechen von Anerkennung, sicheren Arbeitsplätzen und einer guten Infrastruktur ausbleibt, ziehen sich die Menschen ins Nationale zurück. Die Rechten können zwar auch keine sozialen Antworten bieten, aber sie bieten Anerkennung über nationale Identitäten.
Gerade deshalb ist es sozialdemokratische Aufgabe, die von den Rechten instrumentalisierten Ängste zu nehmen und durch ein positives-progressives Bild zu ersetzen. Dazu gehört es auch, der Verachtung von industrieller Arbeitswelt entgegen zu treten. Wer die gesellschaftlichen Spaltungen beenden will, muss Industriepolitik gestalten wollen. Gesellschaftliche Veränderung wie die die ökologische Transformation brauchen politische Mehrheiten.
Ohne handlungsfähige Kommunen gibt es keine gute Zukunft
Der gewaltige Investitionsstau in Deutschland zeigt sich nicht nur bei digitalen und überregionalen Verkehrsnetzen, sondern vor allem auch in den Kommunen. Die Investitionsmöglichkeiten der Kommunen sind dabei regional sehr unterschiedlich. Gerade die Kommunen, die als Globalisierungsverlierer starke Strukturwandel zu bewältigen hatten, wurden in Folge einer erhöhten Arbeitslosigkeit durch die Nichteinhaltung des Konnexitätsprinzips bei Sozialleistungen in den Abbau von freiwilligen Leistungen und die Verschuldung durch Kassenkredite getrieben. Die finanzielle Schieflage vieler Kommunen ist also grundsätzlich nicht die Folge unseriöser kommunaler Finanzplanung, sondern von strukturellen Fehlentwicklungen bei der Kommunalfinanzierung.
Die Folge: Die Kommunen leben nur noch von der Substanz. Seit der Wiedervereinigung sind die kommunalen Investitionen dramatisch eingebrochen, die Nettowerte sind seit sechszehn Jahren in Folge negativ. Die KfW bemisst den kommunalen Investitionsstau auf 138 Milliarden Euro.
Die Konsequenzen sind für die Menschen direkt spürbar: Wenn Schwimmbäder geschlossen werden, wenn kein Bus mehr fährt, wenn die Mietpreise der privatisierten Wohnungen steigen oder wenn die Schulgebäude marode sind, sinkt die Lebensqualität. Für Unternehmen wird es schwer, Fachkräfte in solche Kommunen anzuwerben. Höhere Gewerbesteuern und eine marode Infrastruktur vor Ort führen dazu, dass Unternehmen abwandern.
Kommunen wie Mohnheim nutzen diese Schieflage aus, ziehen mit Niedrigst-Sätzen bei der Gewerbesteuer Unternehmen an und verschlimmern so die finanzielle Schieflage anderer Kommunen. Ein solcher Steuerwettbewerb zwischen den Kommunen mit der Herausbildung kommunaler Steueroasen führt zu keinerlei wirtschaftlichem Fortschritt, sondern zu einer Abwärtsspirale bei der kommunalen Infrastruktur.
Handlungsfähige und investitionsbereite Kommunen werden gebraucht, wenn die Transformationen gelingen sollen. Deshalb muss eine grundsätzliche Neuregelung der kommunalen Finanzen in den Blick genommen werden.
Die europäische Dimension mitdenken
In einer globalisierten Welt reicht eine nationalstaatliche Industrie-Strategie nicht aus – gerade wenn man ein globales Thema wie den Klimawandel damit angehen will. Europa hat einen gemeinsamen Markt, es braucht endlich auch eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Die EU ist noch immer geprägt von der Idee, dass bei einem gemeinsamen Binnenmarkt ein Wettbewerb zwischen den Nationalstaaten zur Herstellung globaler Wettbewerbsfähigkeit förderlich sei. Diese Politik führt allerdings zu einem ruinösen Wettbewerb mit einer Abwärtsspirale bei Löhnen und Arbeitsbedingungen und bietet keine Perspektive, mit chinesischen Staatsunternehmen und US-amerikanischen Tech-Konzernen mithalten zu können.
Dazu kommt eine starke ökonomische Polarisierung Europas, die ihre Ursache nicht nur in unterschiedlichen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, sondern vor allem in der Ungleichheit der Produktionsstrukturen hat. Während etwa Deutschland eine hohe ökonomische Komplexität aufzuweisen hat, haben Griechenland, Spanien, Portugal, Lettland und Estland ein geringes Ausmaß an technologischen Kapazitäten. Die europäische Politik braucht ein gemeinsames Verständnis davon, wie man die europäische Wirtschaft innovativer machen will. Dazu lohnt sich auch ein genauerer Blick auf die Außenhandelsbilanz Deutschlands. Durch niedrige Löhne hat es die Wirtschaft der Bundesrepublik zwar geschafft massive Exportüberschüsse zu erzielen, allerdings sind die Gewinne weder durch eine hohe Importquote ausgeglichen worden, noch über Vermögens- oder Erbschaftssteuern in die Investitionskraft des Staates zurückgeflossen. Während die Wirtschaft von infrastruktureller Substanz gelebt hat, gab es auf Seiten der Vermögensverteilung eine doppelte Umverteilung von unten nach oben: Zum einen in den eigenen Betrieben, wo die Belegschaften nicht im ausreichenden Maße am Exportgewinn beteiligt wurden, und zum anderen zwischen den europäischen Staaten. Denn wo die Importe aus Deutschland kamen, wurden oft mit Schulden bezahlt
Praktisch möglich wird eine solche gemeinsame Politik nur sein, wenn man sich auf ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten einlässt. Vorangehen sollte die Eurozone, ausgestattet mit einem eigenen starken Budget, das für gezielte Investitionen genutzt wird.
Was wir wollen
Konkret fordern wir deshalb:
- Die Schuldenbremse muss wieder aus dem Grundgesetz und den Landesverfassungen gestrichen werden. Der Fiskalpakt der Europäischen Union muss aufgekündigt und neu verhandelt werden mit dem Ziel, fiskalische Stabilität nicht mehr gegen Innovationsfähigkeit auszuspielen.
- Ein Vorrang für Investitionen muss langfristig sichergestellt werden. Deshalb soll eine permanent positive Investitionsquote von 0,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes festgelegt werden.
- Praktisch finden öffentliche Investitionen zu einem großen Teil in den Kommunen statt. Finanziell handlungsfähige Kommunen sind deshalb eine wichtige Voraussetzung für eine Investitionspolitik. Wir setzen daher auf einen Altschuldenfonds für überschuldete Kommunen und eine Neuregelung der kommunalen Finanzierung.
- Die Bundesregierung soll einen Plan aufstellen, in welche Richtung Innovation gefördert und öffentliche Nachfrage im nächsten Jahrzehnt gelenkt werden. Ziel soll dabei sein:
- Mobilität: Bis 2030 soll Deutschland das klimafreundlichste und engmaschigste Mobilitätsangebot weltweit bieten. Dabei gilt es die soziale Dimension von Mobilität und die Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen sowohl in Ballungszentren als auch in weniger besiedelten Räumen mitzudenken. Unser langfristiges Ziel bleibt der ticketlose ÖPNV.
- Wohnen: Bis 2030 soll die öffentliche Hand massiv in den Wohnungsbau investieren. Das ist sowohl für die Ballungsräume mit ihrem Wohnungsmangel als auch für weniger dicht besiedelte Räume relevant, in denen etwa Smart-Home-Lösungen einen besseren Zugang zu medizinischer Infrastruktur ermöglichen können.
- Energie: Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung soll bis 2030 auf mindestens 65 Prozent steigen.
- Die Arbeit und die Ergebnisse der „Kohlekommission“ waren und bleiben wichtig. Unser Anspruch und Ziel ist es aber auch, dass technische und soziale Lösungen für ein Ende des Abbaus und der Verbrennung umweltschädlicher Braunkohle, das deutlich vor 2038 liegt, gefunden und umgesetzt werden.
- Die vor 25 Jahren im neoliberalen Zeitgeist durchgeführte Bahnreform hat sich als Rückschritt für den Schienenverkehr erwiesen: Die Belastung für die Steuerzahler*in ist gestiegen, die Qualität hat abgenommen. Eines der Kernprobleme: Die Bahn befindet sich zwar in staatlicher Hand, eine politische Vorgabe für die strategische Ausrichtung gibt es aber nicht. Und so konzentriert sich die Bahn immer stärker auf das Auslandsgeschäft und niemand fordert den Verfassungsauftrag zum Erhalt und Ausbau der Schienen-Infrastruktur ein. Wir setzen dagegen auf die Idee einer gemeinsamen europäischen Bahngesellschaft, die als zentralen Auftrag nicht die Gewinnmaximierung bekommt, sondern eine Stärkung der Mobilitäts-Infrastruktur, eine Vorreiterrolle in ökologischen Innovationen und eine Beachtung der sozialen Dimension von Mobilität.
- Ein wichtiges Ziel bleibt es, Güterverkehr von der Straße zu holen und gleichzeitig effiziente Transportwege zu ermöglichen. Das heißt, dass nicht nur in die Schiene, sondern auch in den Ausbau von Wasserstraßen investiert werden muss.
- In der Regel wird bei der Produktion die Wiederverwendbarkeit von Produkten nicht in den Vordergrund gestellt. Stattdessen wird bei ausrangierten Maschinen, Autos oder Elektrogeräten erst nachträglich geprüft, welche Bestandteile zu recyclen sind, welche Sonderbehandlungen notwendig sind, welche Giftstoffe teuer behandelt werden müssen, welcher Deponiemüll anfällt und so weiter. Ziel sollte es dagegen sein, jedes Produkt im Hinblick auf seine vollständige Wiederverwendbarkeit zu konzipieren. Die Politik muss für die Schaffung einer solchen Kreislaufwirtschaft die Rahmenbedingungen schaffen. Instrumente dafür sind Förderprogramme, steuerpolitische Anreize oder eine Rücknahmepflicht für bestimmte Produkte.
- Insgesamt können steuerpolitische Anreize helfen, die Produktion nachhaltiger zu gestalten. Maßnahmen dazu können die Streichung umweltschädlicher Subventionen, eine ökologische Spreizung der Mehrwertsteuer oder eine sozial ausgestaltete CO²-Bespreisung sein.
- Oft scheitern wichtige Infrastrukturprojekte an lokalen Protest-Initiativen. Wir brauchen effektive Wege zur Durchsetzung von wichtigen Infrastrukturprojekten, die die Menschen vor Ort frühzeitig informieren und beteiligen.
- Es muss sichergestellt werden, dass innovative Ideen nicht an Kapitalmangel oder fehlender Risikobereitschaft von Kreditinstituten scheitern. Deshalb gilt es – zum Beispiel durch die KfW oder staatliche Fonds – die Finanzierung von Green Tech-Investitionen und Neugründungen sicherzustellen.
- Finanzielle staatliche Förderungen für industriepolitische Maßnahmen sollten degressiv gestaltet und befristet sein. So kann sichergestellt werden, dass die nachhaltig erwirtschafteten Produkte langfristig aus eigener Kraft im globalen Wettbewerb bestehen können.
- Wir brauchen Vorfahrt für grüne Investitionen: Wenn Kommunen, Länder oder der Bund Geld anlegen, sollen sie dies bevorzugt in Unternehmen und Branchen tun, die Umwelt und Klima schützen oder schonen und nicht zu deren Verschmutzung bzw. Wandel beitragen.