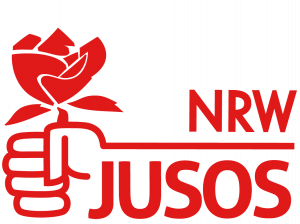Im Juni 1969 stießen Polizist*innen bei einer Razzia in der Christopher Street in New York zum ersten Mal auf Gegenwehr. In dieser Straße befand sich das Stonewall Inn, eine Schwulenbar, in der regelmäßig Polizeirazzien durchgeführt, Gäste aufgeschrieben und sogar festgenommen wurden. Schwule, Lesben und trans* Personen versammelten sich an jenem Tag und standen drei Tage lang für ihre Rechte ein. Das war der Auftakt zur „homosexuellen Befreiung“. Die Community wollte sich nicht mehr verstecken, sondern für ihre Gleichberechtigung kämpfen. Seither findet jedes Jahr ein Gedenkmarsch statt – in Deutschland erinnert seit 1979 der Christopher Street Day an die Geschehnisse.
In den letzten 50 Jahren konnten erhebliche Fortschritte in LGBTQI*-Rechten beobachtet werden – von der Abschaffung von § 175 StGB bis hin zur Öffnung der Ehe für Alle und der Einführung der „dritten Option“ in den letzten zwei Jahren. Allerdings ist das Ziel – die vollständige gesellschaftliche Akzeptanz und Gleichstellung – noch lange nicht erreicht. Auch heute ist Homosexualität noch in 78 Ländern verboten und in acht Ländern sogar unter Todesstrafe gestellt. Jährlich werden weltweit Tausende von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt und umgebracht. LGBTQI* Personen werden von ihren Familien verstoßen, in die Unsichtbarkeit gedrängt und schrecklicher Gewalt ausgeliefert. Auch in westlichen Staaten wird mit sexuellen Orientierungen sehr unterschiedlich umgegangen. Anfeindungen und auch Gewaltanwendungen gegen LGBTQI* Menschen nehmen allerorten wieder zu. Insbesondere sind noch immer ein sehr binäres Bild von Geschlecht und heteronormative Standards vorherrschend. Selbst wenn Schwule und Lesben in der westlichen Welt heute größtenteils heiraten und Kinder adoptieren können, sieht es bei der Akzeptanz von Menschen, die der binären Gendernorm von Mann und Frau nicht entsprechen, noch ganz anders aus. LGBTQI* Rechte dürfen nicht auf Lesben und Schwule beschränkt werden – ein viel breiteres Spektrum muss abgedeckt werden, weshalb eine Abkehr von heteronormativem und binärem Denken notwendig ist, in unserer Gesellschaft und in unserem Verband.
In diesem Antrag werden einige der aktuellen Stellschrauben zur rechtlichen Gleichberechtigung von LGBTQI* beschrieben. Der Antrag hat keinesfalls den Anspruch, abschließend zu sein. Stonewall ist und bleibt ein ewiges, aktives Mahnmal – in den Worten von Martin Boyce, der selbst bei den Protesten anwesend war: „Stonewall ist ein Verb, eine Aufforderung zur Tat“.
Aufnahme von geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung in GG und AGG
Noch immer ist der Katalog der speziellen Diskriminierungsverbote in Artikel 3 des Grundgesetzes unvollständig: sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität werden nicht erwähnt. Dies wirkt sich bis heute negativ auf die Lebenssituation von LGBTQI* aus. Wer dort nicht genannt wird, läuft Gefahr, in der gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit ignoriert zu werden. So musste das Bundesverfassungsgericht durch seine Rechtsprechung in den vergangenen Jahren immer wieder gegenüber diskriminierendem staatlichem Handeln korrigierend eingreifen, um den Grundrechten von LGBTQI*-Menschen auf Gleichbehandlung und freie Entfaltung der Persönlichkeit Geltung zu verschaffen. Gerade gegenüber politischen Kräften, die Demokratie als Diktatur einer vermeintlichen Mehrheit missverstehen, muss ein inklusives Grundrechteverständnis auch im Verfassungstext besiegelt werden. Fundamentale Normen des Zusammenlebens wie das Diskriminierungsverbot müssen in der Verfassung für alle Menschen transparent sein. So wie es in einigen Bundesländern bereits entsprechende Diskriminierungsverbote in der jeweiligen Landesverfassung gibt, müssen diese auf alle Verfassungen ausgeweitet werden.
Zudem muss das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ausgebaut und wirksamer gestaltet werden. So muss auch staatliches Handeln umfassend in den Anwendungsbereich des AGG einbezogen werden. Insbesondere müssen die Diskriminierungsgründe erweitert werden, einschließlich der dezidierten Benennung des Diskriminierungsgrundes „geschlechtliche Identität“.
Ferner müssen die Ausnahmeregelungen im Arbeitsrecht für Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen aufgehoben werden. Es ist einer freien Gesellschaft unwürdig, dass das Eingehen einer gleichgeschlechtlichen Ehe einer Person den Arbeitsplatz kosten kann. Für Beschäftigte der Religionsgemeinschaften und der von ihnen betriebenen Einrichtungen muss außerhalb des engsten Bereichs der Verkündigung das allgemeine Arbeitsrecht einschließlich des Betriebsverfassungsgesetzes Geltung erlangen.
Verbot von Konversionstherapien
Wir fordern, dass die Durchführung aller Maßnahmen, die darauf abzielen eine Veränderung der sexuellen und/oder geschlechtlichen Identität oder Orientierung hervorzurufen, verboten und unter strafrechtliche Verfolgung gestellt werden.
Novellierung der Ehe für Alle
Wir stehen für die Überwindung von stereotypen Geschlechterrollen sowie des binären Verständnisses von Geschlechtlichkeit. Der beschlossene Gesetzesentwurf zur Ehe für Alle erfasst nur Menschen gleichen oder verschiedenen Geschlechts. Hierdurch sind insbesondere inter* und nichtbinäre Menschen von der Eheschließung ausgeschlossen. Die Gesetzgebung hat dies offensichtlich nicht beabsichtigt, sodass mit einer weiteren Novelle die Ehe für wirklich Alle geöffnet werden muss.
Neuregelung des Transsexuellengesetzes (TSG)
Trans* Personen muss es möglich sein, ohne erhebliche Hürden medizinische und rechtliche Geschlechtsangleichungen vorzunehmen. Daher ist eine Reform des TSG von 1980 längst überfällig – auch, wenn das ursprüngliche Gesetz aufgrund der zahlreichen verfassungswidrigen Regelungen bereits größtenteils außer Kraft ist. Im TSG ist geregelt, dass trans* Menschen zur rechtlichen Anerkennung der Geschlechtsangleichung zwei Gutachten anfertigen lassen, dafür die Kosten tragen und in einem Gerichtsverfahren die Änderungen von Vornamen und Personenstand beantragen müssen. Dies stellt einen eklatanten Verstoß gegen das Recht auf Selbstbestimmung von trans* Personen dar.
Den im Mai 2019 von Justizministerin Barley und Innenminister Seehofer vorgelegten Gesetzesentwurf zur Neufassung des TSG lehnen wir dezidiert ab, da er trans* Menschen keine echte Selbstbestimmung erlaubt. Vielmehr hält er am zur Geschlechtsangleichung notwendigen Gerichtsverfahren fest und ersetzt die notwendigen Gutachten durch eine sog. ärztliche Geschlechtsidentitätsberatung. Psycholog*innen und Ärzt*innen dürfen weiterhin das Leben, die Identität und den Körper von trans* Menschen bewerten und begutachten. Während zahlreiche europäische Reformen in den letzten Jahre Begutachtungen, Diagnosen und Fremdbestimmungen abgeschafft haben, hält der neue Gesetzesentwurf an der Fremdbestimmung fest, widersetzt sich den europäischen Menschenrechtsgarantien sowie EU-Vorgaben zur Geschlechtergleichstellung und fällt noch weiter hinter seine europäischen Nachbarn zurück. Wir schließen uns der Kritik des Bundesvorstands der AG Akzeptanz und Gleichstellung (SPDqueer) an, denn der Gesetzesentwurf ist pathologisierend, diskriminierend und nicht zeitgemäß.
Eine Reform des TSG ist längst überfällig, allerdings darf die Neuregelung nicht erneut in einem diskriminierenden Sondergesetz ergehen, sondern muss in das allgemeine Familienrecht des BGB integriert werden. Dabei muss beachtet werden, dass für die Änderungen von Vornamen und Personenstand ausschließlich jenes Geschlecht maßgeblich sein darf, mit dem sich die Person identifiziert. Die Namens- und Personenstandsänderung muss ohne Einholung von Gutachten alleine durch die eindeutige Erklärung eines Menschen bei dem zuständigen Standesamt bzw. dessen Aufsichtsbehörde möglich sein. Dies muss für Minderjährige ab 14 Jahren auch ohne Zustimmung der Eltern möglich sein. Minderjährige unter 14 Jahren benötigen grundsätzlich die Zustimmung der Eltern. Die fehlende Zustimmung kann jedoch durch das zuständige Familiengericht ersetzt werden.
Gleichzeitig muss die medizinische Geschlechtsangleichung im Wege von Operationen und hormonellen Behandlungen allen Menschen offenstehen. Geschlechtsangleichende Operationen dürfen nur bei wirksamer Einwilligung der Person erfolgen, an welcher diese durchgeführt werden. Trans* ist keine Krankheit, sondern eine Ausprägung der geschlechtlichen Identität. Die Behandlungen müssen auch Minderjährigen offenstehen, um ungewollte Veränderungen am eigenen Körper (insbesondere durch Einsetzen der Pubertät) verhindern zu können, selbst gegen den Willen der Eltern. Zudem müssen die Kosten für alle geschlechtsangleichenden Behandlungen einheitlich von Krankenkassen übernommen werden. Das Angebot für psychologische Therapie muss trans* Personen kostenlos und barrierefrei zur Verfügung gestellt werden.
Abstammungsrechtsreform
Das geltende Abstammungsrecht wird aktuellen Lebensrealitäten nicht ausreichend gerecht, denn die Vielfalt der heutigen Familienkonstellationen und die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin stellen es vor erhebliche Herausforderungen. Die Schwierigkeiten ergeben sich aus der multiplen Elternschaft, von der neben der Regenbogenfamilie auch andere Familienformen betroffen sind – die bio-genetischen Elternteile sind nicht automatisch auch rechtliche oder soziale Elternteile. In der Folge stellt sich für diese Familien die Frage, mit welchen Rechten und Pflichten soziale Elternteile ausgestattet sind und wie im Alltag mit möglichen Diskrepanzen zwischen rechtlicher und sozialer Elternschaft umgegangen wird. In der gegenwärtigen Situation sind beispielsweise gleichgeschlechtliche Ehepaare zweier Frauen auf eine sehr aufwändige Stiefkindadoption des in der Ehe geborenen Kindes angewiesen; faktische Lebensgemeinschaften zweier Frauen* sind gar ganz von der gemeinsamen rechtlichen Elternschaft ausgeschlossen. Diese Situation ist nicht nur für die betroffenen Frauen*, sondern auch für die Kinder nicht tragbar, denen ein zweites Elternteil zumindest zeitweise, wenn nicht dauerhaft vorenthalten wird und die so im Hinblick auf Unterhaltsansprüche und Erbrecht schlechter gestellt werden.
Somit ist eine Anpassung des Abstammungsrechts, welche den vielfältigen real existierende Familienstrukturen Rechnung trägt, überfällig. Das Rechtssystem darf keine Hürde für Familiengründungen in neuen Konstellationen darstellen.
Daher ist der im März 2019 von Justizministerin Barley vorgelegte Entwurf zur Anpassung des Abstammungsrechts grundsätzlich zu begrüßen. Grundlegend für Barleys Vorhaben ist weiterhin die „genetisch-biologische Verwandtschaft“. Dennoch soll es beispielsweise lesbischen Paaren möglich sein, von Geburt an als rechtliche Eltern eines Kindes zu gelten.
Mit dem „Zwei-Eltern-Prinzip“ wird Elternschaft auch weiterhin beschränkt und schwule Eltern können weiterhin erst durch Adoption vollständig rechtlich Eltern werden. Zwar räumt Barleys Entwurf ein, wie wichtig die „sozio-familiäre Beziehung“ sei, behält jedoch starre Grenzen bei. Der Entwurf bildet noch lange nicht alle Lebensrealitäten ab, weshalb eine grundlegendere Reform notwendig ist.
Zudem enthält der Gesetzesentwurf zahlreiche problematische Punkte, wie beispielsweise die bestehende Rechtsunsicherheit für die möglichen Elternteile aufgrund der Unterscheidung zwischen privaten Samenspenden und ärztlich assistierter künstlicher Befruchtung. Außerdem birgt der Entwurf deutliche Widersprüche gegenüber trans* Personen. Zweigeschlechtlichkeit bleibt zentral, die Rolle der Mutter wird strikt biologisch festgeschrieben und eine dritte Geschlechtsoption wird nicht berücksichtigt. Zwar wird im Gesetzestext angekündigt, dass inter* und trans* Menschen jede Rolle in der Elternschaft einnehmen könnten, dies steht jedoch im Widerspruch zum biologischen Mutterschaftsbegriff. Gebärende Männer oder zeugende Frauen ebenso wie diejenigen Personen, die sich nicht einem binären Geschlecht zuordnen wollen, werden dadurch in ihrer geschlechtlichen Selbstbestimmung eingeschränkt.
Folglich sind Neuregelungen notwendig, welche die genannten unterschiedlichen Lebensrealitäten und -umstände berücksichtigen.
Insbesondere sind klare Regelungen erforderlich, die Rechtssicherheit z.B. bei künstlicher Befruchtung erlauben. Dazu gehört die Anerkennung der Elternschaft, z.B. („Mit-“)Mutter*schaft bei lesbischen Paaren, abhängig von der intendierten sozialen Beziehung zum Kind – und die Abkehr von der vorrangig genetisch bestimmten Elternschaft. In dem Zusammenhang ist eine präkonzeptionell zulässige Möglichkeit des bindenden Verzichts des*der Samenspender*in auf Elternrechte einzurichten, die dem Interesse der Mütter*paare an einer geregelten Rechtslage ebenso Rechnung tragen würde, wie dem Interesse des*der Samenspender*in daran, nicht entgegen vorheriger Absprache auf Unterhalt in Anspruch genommen zu werden. Ein solcher Verzicht auf Elternrechte muss auch bei privaten Samenspenden möglich sein.
Darüber hinaus ist die Kostenübernahme der ärztlich assistierten Insemination für gleichgeschlechtliche Paare über § 27a SGB V sicherzustellen.
Zudem ist die Zulässigkeit der Insemination mit Fremdsamen im ärztlichen Berufsrecht ausdrücklich klarzustellen und die Frage der Zulässigkeit der assistierten Reproduktion bei gleichgeschlechtlichen Ehegattinnen*, bei Lebenspartnerinnen*, bei gleichgeschlechtlichen eheähnlichen Lebensgemeinschaften von Frauen* und bei alleinstehenden Frauen* zu klären.
Weiterhin ist eine grundlegende Reform des Fortpflanzungsmedizinrechts, mitsamt klarer Regelung von Embryonenspenden, überfällig. Anderenfalls droht ein unterschwelliger Widerspruch in der Rechtsordnung, wenn das BGB-Familienrecht z.B. die Embryonenspende zumindest eingeschränkt als zulässig voraussetzt.
Zuletzt besteht die Notwendigkeit für trans* Eltern, auch im Geburtsregister ihrer Kinder entsprechend dem gelebten Geschlecht bezeichnet zu werden. Auch der Alltag mit minderjährigen Kindern wird durch eine fehlende geschlechtsentsprechende Zuordnung erheblich erschwert. Dies kann durch eine Abkehr von der zwingenden Kategorisierung als Vater oder Mutter gewährleistet werden, die den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich einer „dritten Option“ entsprechen würde.
Recht auf Asyl
Obwohl sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität zumindest im europäischen Asylrecht mittlerweile flächendeckend als Fluchtgrund anerkannt sind, gibt es noch einige gegenläufige Praktiken, die durch das BAMF und durch Verwaltungsgerichte gepflegt werden. Zum Beispiel werden Asylanträge nicht selten mit der Begründung abgelehnt, es werde in den Heimatstaaten der Geflüchteten nicht gezielt nach LGBTQI* Personen gefahndet, weshalb eine dortige strafrechtliche Verfolgung sehr unwahrscheinlich wäre. Dies kommt der Zumutung gleich, im Herkunftsstaat die eigene geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung, und damit einen Teil der eigenen Identität zu verstecken, um Verfolgung zu vermeiden.
Eine weitere Hürde für Personen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität verfolgt wurden, ist die (öffentliche) Angabe ihrer LGBTQI* Zugehörigkeit als Fluchtgrund anzugeben – insbesondere aufgrund der gemeinsamen Unterbringung in Unterkünften mit anderen Geflüchteten, wo ein Outing zu erneuten Anfeindungen führen kann. Das Nicht-Angeben bzw. nachträgliche Ändern des Fluchtgrundes kann allerdings zu erheblichen Problemen im Gerichtsverfahren führen, da es die Aussagen des*der Asylsuchenden für Richter*innen unglaubhaft erscheinen lassen kann.
Eine Reform im Asylverfahren, die sichere Räume für LGBTQI* Geflüchtete schafft und rechtswidrige Praktiken durch das BAMF und Verwaltungsgerichte unterbindet, ist dringend notwendig.
Fazit
Offensichtlich werden durch die Durchsetzung der beschriebenen Forderungen bestehende Ressentiments, Diskriminierungen und Gewalt gegen LGBTQI* nicht mit einem Schlag verschwinden. Gegen Hetze und Hass ist noch viel Aufklärungs- und Präventionsarbeit von Nöten. Dennoch kann Gesetzgebung das Bewusstsein positiv verändern, das ist empirisch messbar. Und auf dem Weg zur gesellschaftlichen Akzeptanz und Gleichstellung ist die vollständige rechtliche Gleichberechtigung ein essenzieller Schritt.
Deshalb fordern wir
- Die Aufnahme von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität ins Grundgesetz.
- Den Ausbau des AGG hinsichtlich sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität.
- Die Abschaffung von Ausnahmeregelungen im Arbeitsrecht von Religionsgemeinschaften.
- Das Verbot von Konversionstherapien und die strafrechtliche Verfolgung dieser.
- Novellierung des Ehe für Alle-Gesetzes mit einer Öffnung für nichtbinäre und inter* Menschen.
- Die Aufhebung des Transsexuellengesetz und eine grundlegende Neuregelung, die der Menschenwürde von Trans* gerecht wird. Jede*r sollte im Wege einer eindeutigen Erklärung frei über den eigenen Geschlechtseintrag entscheiden können, ohne Atteste vorlegen zu müssen. Den vom Justizministerium vorgelegten Entwurf zur Neuregelung lehnen wir ab.
- Eine kostenfreie medizinische sowie juristische Geschlechtsangleichung in jedem Fall. Geschlechtsangleichende Operationen dürfen nur bei wirksamer Einwilligung der Person erfolgen, an welcher diese durchgeführt werden. Krankenkassen müssen für die notwendigen Behandlungen aufkommen.
- Ein kostenloses und barrierefreies Angebot für psychologische Therapie für trans* Menschen.
- Eine Neuregelung des Abstammungsrechts, sodass dieses gesellschaftliche Realitäten widerspiegelt und die Gleichberechtigung von Regenbogenfamilien garantiert.
- Die Sicherstellung der Kostenübernahme der ärztlich assistierten Insemination für gleichgeschlechtliche Paare über § 27a SGB V.
- Eine Reform im Asylverfahren, die sichere Räume für LGBTQI* Geflüchtete schafft und rechtswidrige Praktiken durch das BAMF und Verwaltungsgerichte unterbindet, ist dringend notwendig.