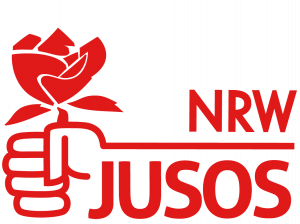Können Eltern frei entscheiden, wie sie mit der Privatsphäre ihrer Kinder im Zeitalter der sozialen Medien umgehen? Dürfen bereits Kinder als Influencer tätig sein? Handelt es sich hierbei noch um ein Hobby oder schon um (regulierte bzw. zu regulierende) Arbeit?
Im Zusammenhang mit dem Auftauchen von Minderjährigen auf sog. Influencer-Kanälen verschmelzen mit dem Recht am eigenen Bild und dem Kinder- und Jugendarbeitsschutz zwei hochgradig grundrechtsrelevante, für eine gesunde kindliche Entwicklung bedeutsame Problemkomplexe. Trotz des Schlaglichts, welches die bereits länger geführte Diskussion um eine Verfassungsergänzung auf das Thema der Kinderrechte wirft, wird das Kind als Darsteller auf einem eigenen oder elterlichen Account in Recht und Politik bisher kaum adressiert, maximal ab und an z.B. durch Warnungen der Polizei. Jedoch: Mantra-artige Empfehlungen reichen nicht; professionelle, ausführliche Beratungsangebote, insb. in Schulen, Kitas etc. sind notwendig.
Kindliche Entwicklung schützen, Eltern aufklären
[Triggerwarnung: Sexuelle Gewalt gegen Kinder]
Prominente Beispiele, wie der YouTube-Kanal „Mileys Welt“ oder „Team Harrison“ zeigen, dass es im Zusammenhang mit Sharenting, Kinder-Influencing und Social Media massiven Aufklärungsbedarf gibt.
Insbesondere verschwimmen oft die Grenzen zwischen dem Kinderzimmer als Rückzugsort und dem Kinderzimmer als Arbeitsplatz. Das Kinderzimmer bzw. der kindliche Rückzugsort ist von besonderer Bedeutung für die kindliche Entwicklung, ein Eingriff in diesen Rückzugsort ist ein Eingriff in die Privatsphäre des Kindes, es gilt diesen Raum zu schützen und angemessen zu präsentieren, ein Eingriff ist sorgfältig abzuwägen.
Die Gefahr durch Sexualisierung von Kindern und Jugendlichen durch Dritte ist zwar etwas bekannter, allerdings sind sich viele Eltern nicht über die technische Funktionsweise von Social Media-Plattformen bewusst. Algorithmen, die vermeintlich „freizügige Inhalte“ belohnen und anderen Nutzer*innen somit häufiger anzeigen, sind häufig unbekannt, die daraus resultierende Gefahr, dass Bilder auf kinderpornografischen Plattformen gepostet werden, steigt in den vergangenen Jahren, das kann zur Traumatisierung und einer gestörten sexuellen Entwicklung des Kindes führen.
Ein dritter Aspekt umschreibt die Nutzung von Social Media für Kinder, hier ist wichtig zu betonen, dass die Nutzung von Social Media nicht den Status eines Hobbies oder einer Freizeitbeschäftigung überschreiten sollte, das bedeutet, dass es eine klare Reglementierung und Integration in den Alltag geben muss. Die Eltern sind angehalten, ihr Kind und sich zu überprüfen, ob es sich bei der Nutzung noch um eine Freizeitbeschäftigung handelt oder schon mit Arbeit zu vergleichen ist.
Außerdem gilt es für die Eltern sorgfältig abzuwägen, wie sie ihr Kind zeigen bzw. wie sich das Kind zeigt. Eltern sollten sich, insbesondere bei Kleinkindern, die Fragen stellen, ob sie die Privatsphäre des Kindes ausreichend schützen und die Gefahren abwägen können. Zeigen Sie das Kind eventuell in einer Situation die es als unangenehm empfindet oder die Schamgrenzen überschreitet? Diese Fragen sind besonders im Kontext der Beziehung zwischen Eltern und Kind in der fortschreitenden Entwicklung des Kindes von herausragender Bedeutung.
Damit Eltern in der Lage sind, eine angemessene kindliche Entwicklung zu gewährleisten und die Herausforderungen und Gefahren von Sharenting, Influencing und genereller Nutzung von Social Media einschätzen zu können, bedarf es die Unterstützung seitens der Politik, insbesondere der Institutionen, die der Staat als Begleiter*in kindlicher Entwicklung beauftragt hat, wie Kindertagesstätten, Schulen etc.
Deshalb fordern wir Aufklärungs- und Informationsangebote, die der Staat in Zusammenarbeit mit den Institutionen entwickeln soll. Diese sollen folgende Punkte umfassen:
- Herausstellen des Kinderzimmers als Rückzugsort von zentraler Bedeutung für die kindliche Entwicklung und des Bedarfs nach angemessener Abwägung bei Eingriffen in diesen, durch besondere Privatsphäre definierten Raum
- Aufklärung von Gefahren durch die Sexualisierung der Inhalte durch Dritte
- Die Notwendigkeit, die Rolle von Social Media im Alltag klar zu definieren, zu reglementieren und regelmäßig zu überprüfen
- Die regelmäßige (Selbst-)Überprüfung auf die Frage der angemessenen Darstellung, die die Privatsphäre und Schamgrenzen des Kindes achtet
Problemfelder erkennen und in Gesetzgebung und Verwaltung tätig werden
Wir fordern die Durchsetzung des Schutzes der Kinderrechte auch in sozialen Netzwerken, insbesondere im Zusammenhang mit dem Auftauchen von Minderjährigen auf sog. Influencer-Kanälen, sei es auf eigenen oder auf von den Eltern betriebenen. Dies ist die ganz praktische Umsetzung des Gedanken, der auch hinter der Kinderrechte-in-die-Verfassung-Debatte steckt: Kinder sind als Subjekte zu sehen, ihnen ist Beteiligung ermöglichen und ihr Recht auf eine offene Zukunft ist zu sichern.
Das Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 GG („Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvorderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“) enthält zweierlei: Das Recht der Eltern, ihre Erstverantwortung für das Kindeswohl auszuüben, dementsprechend alle Entscheidungen für das Kind zu treffen; aber auch das sog. Wächteramt des Staates, welcher (nur) im (Not-)Fall einer Kindeswohlgefährdung einschreitet. Das erwähnte Recht der Eltern ist jedoch, wie auch das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit mehrfach festgestellt hat, ein „dienendes“ Grundrecht, es wird durch seine Fremdnützigkeit für das Kind bestimmt. Eltern haben also bei ihren Entscheidungen die Rechte ihrer Kinder miteinzubeziehen, um ihr Bestes zumindest anzustreben.
Kinder sind Grundrechtsträger*innen, sie haben ein Recht auf (digitale) Entwicklung (Allgemeines Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG; Art. 13, 17, 31 der UN-Kinderrechtskonvention) und auf Privatleben (Allgemeines Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG; Art. 16 der UN-Kinderrechtskonvention; Art. 7 EU-Grundrechtskonvention). Diese sind notwendigerweise zu schützen – um eine offene Zukunft zu gewährleisten und dem Kind zu ermöglichen, auch im digitalen Raum einen eigenen, sicheren Umgang mit der eigenen Privatsphäre und der anderer zu entwickeln.
Sie sind auch Träger*innen des Rechts am eigenen Bild als Teil des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das Problem ist, dass nirgendwo explizit geschrieben steht, wer denn zuständig dafür ist, die Einwilligung in eine Bildveröffentlichung zu erteilen. Wegen der weiten Elternverantwortung liegt der Gedanke an die Eltern natürlich nahe; die Reife des Kindes (zur Selbstentscheidung) ist jedoch ebenso einzubeziehen wie das Spannungsfeld, welches sich im Kontext der Veröffentlichung auf elterlichen Accounts darstellt: Die Eltern erteilen die Erlaubnis sich selbst. In anderen (insb. finanziellen) Kontexten spricht man hier von einem sog. Insichgeschäft; Konsequenz ist, dass nicht die Eltern entscheidungzuständig sind, sondern vom Familiengericht ein Ergänzungspfleger zu bestellen ist, der die Entscheidung trifft (z.B. ein vom Kind geerbtes Haus an die Eltern zu übertragen). In Fällen wie diesen, die für das Persönlichkeitsrecht relevant sind, wird dies jedoch leider oft übersehen. Dabei ist auch hier der Interessenkonflikt offensichtlich: Die Eltern sich zugleich Beschützer*innen als auch Manager*innen bzw. Unternehmer*innen gleichzeitig. Sie haben starke Eigeninteressen, die die Fremdnützigkeit ihrer Entscheidungen vielleicht in den Hintergrund treten lassen.
Zudem gilt das Verbot von Kinderarbeit und dem Kindeswohl abträglicher Ausbeutung (u.a. Art. 32 und 36 UN-Kinderrechtskonvention, Art. 32 EU-Grundrechtskonvention, Jugendarbeitsschutzgesetz). Kinder sind, schon wegen ihrer andauernden Entwicklung, auch in diesem Bereich besonders zu schützen. Eine Ausbeutung in Form des „Mitverdienens“ des Familienunterhalts kann schädliche Rollenerwartungen und einen daraus resultierenden Druck auf das Kind ausüben; zudem besteht die Gefahr, dass entwicklungs- und zukunftsrelevante Tätigkeiten, wie der Schulbesuch, der Kontakt zu Peer-Groups, Hobbies etc. vernachlässigt werden. Das Problem ist jedoch im Kontext von Kindern im Influencer-Marketing das Folgende: Liegt hier eine „Arbeit“ vor bzw. eine „Beschäftigung“, die für die Anwendbarkeit des Jugendarbeitsschutzgesetzes vonnöten ist? Es handelt sich um eine komplizierte juristische Prüfung des Einzelfalls mit hinzutretenden praktischen Ermittlungsproblemen. Jedenfalls zeigen die Reaktionen der zuständigen Landesministerien auf eine Anfrage hin, dass sie die Lage der im Influencer-Marketing tätigen Kinder nicht wirklich auf dem Schirm haben und z.B. bei Kindern U3 – die besonders gefährdet sind (willenloses Objekt) – gar nicht erst eine Anwendbarkeit des JArbSchG annehmen (s. dazu z.B. auch – öffentlich zugänglich – LT-Drs. 17/10300 (NRW) sowie Lemmert, Die Vermarktung des Kindes im Influencer-Marketing, Buch im Erscheinen, vssl. Anfang 2022).
Wir stellen fest, dass die derzeitige Rechtslage nicht hinreichend deutlich oder unzureichend ist. Dies steht in Konflikt zu geltendem Verfassungs- und Völkerrecht. Auch die exekutive Durchsetzung bestehender Gesetze lässt zu wünschen übrig: Insbesondere kontrollieren die Jugendämter und die Gewerbeaufsicht derzeit nicht proaktiv die Kindeswohlverträglichkeit bzw. die Einhaltung der Regelungen des Kinder- und Jugendarbeitsschutzes bei solchen Auftritten. Dies ist jedoch erforderlich: Angesichts der zunehmenden Verbreitung entsprechender Aufnahmen im Internet und der vielfältigen damit verbundenen Risiken, darf der Staat es nicht dem Zufall überlassen, ob er hiervon Kenntnis erlangt und auf Basis dessen seinem grundgesetzlichen Schutzauftrag nachkommen kann. Dies muss gerade in Anbetracht der quasi non-existenten Hindernisse für Sachverhaltsermittlung und -sicherung gelten, die durch die von den Accountinhabern selbst gewählten Öffentlichkeit und nahtlosen Dokumentation herbeigeführt werden.
Wir fordern die Erarbeitung eines Schutzkonzepts, welches die folgenden Aspekte umsetzt:
- Es ist angemessen in Rechnung zu stellen, dass die Eltern als natürliche Sorgeberechtigte unmittelbarer Akteur sind; vor dem Hintergrund des Elternrechts aus Art. 6 Abs. 2 GG, aber auch der Tatsache, dass keine weitere, verlässliche Kontrollinstanz vorhanden ist (Verantwortungsdiffusion).
- Es gilt, das richtige Maß zu finden zwischen Kindesschutz sowie Sensibilisierung für die Gefahren der Veröffentlichungen und der Tatsache, dass das Kind für kommerzielle Zwecke vermarktet wird, auf der einen Seite und dem Belassen von genügend Freiräumen für kreatives Ausprobieren und für die Familie auf der anderen Seite.
- Hierfür muss die Basis sein, dass eine Abgrenzung des privaten und des (auch) kommerziellen Sharentings erfolgt; die Gefährdungslage ist nämlich unterschiedlich.
- Die zu ergreifenden Maßnahmen müssen sich graduell an die Gefährdungslage anpassen – von (im Fall des rein privaten Sharenting) freiwilligen zu (bei zumindest auch-kommerziellen Sharenting) verpflichtenden Beratungsangeboten und Genehmigungserfordernissen bei gleichzeitiger proaktiver Überwachung.
- Denkbar sind folgende Maßnahmen:
- Anwendung des JArbSchG auf alle Gruppen der kommerziell im Internet auftretenden Kinder: als „Beiwerk“ elterlicher Account, als (vermeintlich) selbstständige Kinder-Influencer*innen und insbesondere auch Kleinkinder
- gesetzliche Klarstellung des Rechts auch des Kindes am eigenen Bild
- Sicherstellung des finanziellen Profits von rechtmäßigerweise als Influencer tätigen Kindern, z.B. durch Einführung eines Treuhandkontomodells
- Stärkung der Verantwortung der Plattformbetreiber, insbesondere Pflicht zur Kontrolle von Arbeitserlaubnis etc.
- Einführung eines (subsidiären) Verbandsklagerecht für Kinderschutzorganisationen
Dringlichkeit der Regulierung
Die Reaktionen der Landesregierungen und anderer Akteur*innen in der Vergangenheit zeigen, dass Digitalpolitik oft von Menschen gemacht wird, die sich kaum mit dem digitalen Raum auskennen, dies gilt insbesondere für den digitalen Kinderschutz, der bisher kaum als Problem anerkannt wird. So fehlen bisher konkrete Bemühungen, Kinderschutz im digitalen Raum zu gewährleisten und die Gefahren für Kinder zu minimieren, sowie Familien aufzuklären. Dabei ist das Internet schon lange kein „Neuland“ mehr.
Die Social Media-Plattformen versuchen weder technisch noch in der Kommunikation ihrer Verantwortung gerecht zu werden und verweisen konsequent auf selbstauferlegte, aber leicht umgehbare Altersgrenzen. Eltern und Kinder sind nicht hinreichend sensibilisiert oder es besteht ein Interessenkonflikt. Hier muss die Politik konsequent eingreifen und einen rechtlichen Rahmen schaffen und die Verantwortung der Plattformen einfordern.
Eine Reaktion seitens aller Akteur*innen ist notwendig, besonders in Situationen, in denen das Kinderzimmer nicht mehr Rückzugsort, sondern Arbeitsplatz ist, in denen das Kind für das Haushaltseinkommen mitverdient, in denen das Kind Gefahren, wie Sexualisierung oder Cyber-Mobbing ausgesetzt wird und in denen die Privatsphäre und Schamgrenzen des Kindes nicht geachtet werden. Die Hauptverantwortung liegt hier weiterhin bei den Eltern, jedoch sind Staat und Plattformbetreiber*innen angehalten, diese zu unterstützen, unter anderem durch Reglementierung, Gesetzgebung, Anpassung von Algorithmen, sowie Aufklärung und Information in den Räumen, in denen sich Eltern und Kinder bewegen.
Es gilt die kindliche Entwicklung digital zu denken und optimale Bedingungen zu schaffen.