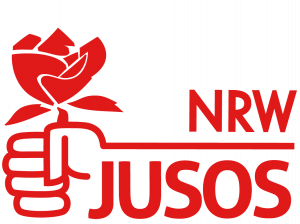Einordnung des NSU-Komplex
Am 4. November 2011 steht in einem Wohngebiet in Eisenach ein weißes Wohnmobil. Zwei Streifenpolizisten näherten sich diesem gegen 12 Uhr. Es sind Schüsse zu hören und kurz darauf gibt es einen Knall, das Wohnmobil geht in Flammen auf. Darin befanden sich die beiden Neonazis und Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. In Zwickau verlässt die Komplizin von Mundlos und Böhnhardt und ebenfalls Neonazi Beate Zschäpe gegen 15 Uhr eilig das Mehrfamilienhaus, in dem kurz darauf die Wohnung des Trios explodiert. In den nächsten Tagen flüchtet Zschäpe quer durch die Bundesrepublik und verteilt DVDs mit dem Bekennervideo zu den Taten des Trios an Redaktionen und Polizeistationen. Am 8. November 2011 endet Zschäpes Flucht, sie stellt sich auf einer Polizeistation in Jena. Was in den folgenden Wochen und Monaten klar wird, ist das Ausmaß der rassistisch motivierten Verbrechen des nationalsozialistischen Untergrunds, das eklatante Versagen der Ermittlungsbehörden von Polizei bis Verfassungsschutz sowie die Folgen gesellschaftlicher Ignoranz gegenüber der Gefahr des Rechtsextremismus.
Vom 9. September 2000 bis zum 6. April 2006 ermordete der NSU Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodorus Boulgarides, Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat. Sie alle waren Kleinunternehmer mit türkischem oder griechischem Migrationshintergrund. Die Morde waren rassistisch motiviert. Außerdem erschoss der NSU am 25. April 2007 die Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn. Des Weiteren sind dem NSU zwei Sprengstoffanschläge, ein Nagelbombenattentat und zahlreiche Raubüberfälle zuzurechnen.
Die Ermittlungen in den Mordfällen waren geprägt von Rassismus und Antiziganismus. Hinweise von den Angehörigen es könne sich um rechte Straftaten handeln, wurden von den Ermittlungsbehörden nicht ernst genommen. Stattdessen wurde ein nicht existierender Zusammenhang zur türkischen Mafia herbei imaginiert. Erst durch die Selbstenttarnung des NSU wurde den Ermittler*innen klar, dass es sich um rechtsextrem motivierte Morde handelt. Daraufhin warfen sich Fragen auf, wie das Trio so lange unbemerkt abtauchen und morden konnte, welches Netzwerk das Trio gehabt hat und welche Rolle der Verfassungsschutz gespielt hat. 2013 kommt es zum Prozess gegen Beate Zschäpe und drei Unterstützer des NSU. Nach dem Urteil 2018 bleiben dennoch viele Fragen offen.
Das Kerntrio des NSU stammt aus Jena in Thüringen. Dort lernten sie sich kennen und radikalisierten sich in den 1990er Jahren. Das Trio war in der rechtsextremen Szene gut vernetzt und in den rechtsextremen Gruppierungen Thüringer Heimatschutz und Nationaler Widerstand Jena. Während der Behörden und Gesellschaft das rechtsextreme Problem in Jena bekannt war, konnten die drei sich radikalisieren, Bombenattrappen deponieren und in einer Garage ihre Bombenwerkstatt mit funktionsfähigen Rohrbomben einrichten. Als diese 1998 entdeckt wurde, war das Trio schon untergetaucht.
Nach dem ersten NSU-Prozess und 10 Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU ist von Aufklärung, Konsequenzen und Erinnerung noch viel zu wenig zu sehen. Wie konnte sich das Trio ungehindert radikalisieren, untertauchen und morden? Warum waren die Ermittlungen voller Fehler? Was wusste der Verfassungsschutz? Wie sieht das Netzwerk des Trios aus? Gibt es weitere Opfer? Gibt es weitere Täter*innen?
V wie Versagen
52 Kontakte der Neonaziszene wurden am 26. Januar bei der Durchsuchung der Bombenwerkstatt von UWE Böhnhardt sichergestellt, nachdem die Neonazis verschiedene Organisationen mit Briefbombenattrappen bedrohten. Die Durchsuchung offenbarte schon früh in den Ermittlungen zum NSU-Komplex die Verbindung von Verfassungsschutz und NSU. Insgesamt 4 Kontakte sogenannter V-Personen, menschlicher Quellen von Polizei und Geheimdiensten innerhalb der Neonazi-Szene, fanden sich auf der als Garagenliste bekannten Kontaktsammlung. Unter ihnen auch der Gründer und Kopf der Kameradschaft Thüringer Heimatschutz (THS), Tino Brandt. Als Informant des Verfassungsschutzes lieferte Tino Brandt dem Geheimdienst Erkenntnisse zur Thüringer Neonaziszene und erhielt im laufe seiner Tätigkeit im Gegenzug rund 200.000 DM vom Verfassungsschutz. Geld, das direkt für den Aufbau der Neonazistruktur, in der sich die NSU-Haupttäter Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe bis zu ihrem Gang in den Untergrund radikalisierten, verwendet wurde. Ein Ermittlungsverfahren, das zum Verbot des THS geführt hätte, wurde nach Aussage eines Kriminalbeamten behindert und später 1997 eingestellt. Tino Brandt war dabei nicht die einzige V-Person, die den THS mutmaßlich mit Geldern des Verfassungsschutzes im Aufbau unterstützte.
Hat der Verfassungsschutz den Aufbau des THS gezielt gefördert, um einfacheren Zugang und Einblick in die rechtsradikale Szene zu erhalten? Wurde auf polizeiliche Ermittlungsverfahren Einfluss genommen? Und wie konnte aus dem gut beobachteten THS der NSU entstehen ohne, dass der Verfassungsschutz, nach eigener Angabe, Kenntnis über Aufenthaltsorte der Terrorist*innen hatte? Diese und weitere Fragen konnten bis heute nicht geklärt werden, weil die Bundesanwaltschaft und der Geheimdienst immer wieder Informationen im Prozess zurück hielten, die ihre V-Männer hätten belasten können.
Dabei nimmt das Unterstützer*innen-Netzwerk von V-Personen immer wieder wichtige Rollen in der Vorbereitung der Mordanschläge und der Finanzierung des Untergrundlebens ein. Tino Brandt organisierte Spendensammlungen auf Konzerten. Thomas Starke, Verbindungsperson des LKA Sachsen, unterstütze den NSU bei der Suche nach einem Unterschlupf in Chemnitz und besorgte Uwe Böhnhardt das TNT, das später für die Bombenattrappen verwendet wurde. Jule W. half Beate Zschäpe im Untergrund und war mehrmals in der Zwickauer Wohnung. Tino S. wurde nur wenige Tage vor dem Mord des Dortmunder Kioskbesitzer Mehmet Kubaşık mit Uwe Mundlos in der Nähe des späteren Tatorts gesichtet.
Die fragwürdige Rolle des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex beschränkt sich jedoch nicht auf die V-Personen in der Szene. Die Rolle des Verfassungsschützers und V-Führers Andreas Temme beim Mord an Halit Yozgat in einem Kasseler Internetcafé konnte im NSU-Prozess trotz widersprüchlicher Aussagen nicht vollständig aufgeklärt werden. Am 06. April 2006 stürmen die Täter in das Internetcafé und erschießen den 21-Jährigen. Während des Mordes befindet sich der Beamte Andreas Temme im Hinterraum des Cafés, in dem er regelmäßig Gast ist, und will nichts vom Mord bemerkt haben. „Sehr, sehr unglaubwürdig“, wie ein Beamter im Ermittlungsverfahren gegen Temme feststellt und später durch ein forensisches Gutachten bestätigt wurde.Die Reihe von Lügen und Schutzbehauptungen erschienen den Richter*innen im Prozess als glaubwürdig.
Auch wenn die Anwesenheit des Agenten im Internetcafé nur Zufall gewesen sein sollte, bleibt vom Kasseler Mordfall eine lange Liste von Behinderungen des Ermittlungsverfahrens durch den Verfassungsschutz und ein politischer Skandal um einen Ministerpräsidenten, der die Vernehmung von weiteren Quellen des Verfassungsschützers verhinderte.
Aufklärung
Bei der Gedenkfeier für die Ermordeten am 23. Februar 2012 versprach Bundeskanzlerin Angela Merkel die lückenlose Aufklärung. Zehn Jahre später sind die Lücken aber noch lange nicht geschlossen. Ein erster Schritt muss die sofortige Freigabe der NSU-Akten sein, die für mehrere Jahrzehnte unter Verschluss gehalten werden sollen. Um die rechten Netzwerke, Unterstützer*innen und die Rolle der Ermittlungsbehörden umfänglich aufzudecken, muss der Inhalt der Akten zugänglich sein. Außerdem dürfen die Akten nicht geschwärzt sein und es muss aufgeklärt werden, warum 2012 vom Verfassungsschutz Akten zum NSU vernichtet wurden. Eine Rekonstruktion der Akten bzw. des Inhalts muss so gut wie möglich stattfinden. Dazu gehört auch, dass vom Verfassungsschutz eingesetzte V-Männer aussagen und die Behörde die Aufklärung nicht mehr aktiv verhindern darf. Des Weiteren muss die Frage geklärt werden, wie es sein kann, dass im Umfeld des Kerntrios mehrere V-Männer vom Verfassungsschutz positioniert wurden und trotzdem keine Morde verhindert wurden und das Kerntrio erst durch die Selbstenttarnung aufflog. Dabei stellt sich auch die Frage was der Verfassungsschutz wusste und damit auch die Frage danach, ob und wenn ja was diese Behörde vertuschen will.
Eine weitere Frage, die es unbedingt zu klären gilt, ist die wie und warum die Tatorte und die Opfer ausgewählt wurde. Im Prozess sagte Zschäpe aus, dass sie immer erst im Nachhinein von den Taten erfahren habe, was aus verschiedenen Gründen allerdings unglaubwürdig ist. Für die Angehörigen der Opfer stellt die Beantwortung dieser Frage eine zentrale Rolle in der Aufklärung. Das Kerntrio lebte in Chemnitz und später in Zwickau. Die Tatorte waren in Nürnberg, Rostock, Kassel, Dortmund, München, Hamburg, Köln und Heilbronn. Außerdem waren die Tatorte nicht an öffentlichen Plätzen, sondern gezielt in Geschäften von Menschen mit türkischer oder griechischer Migrationsgeschichte. Bei genauerer Betrachtung der Fälle wird deutlich, dass die Taten mittels einer genaueren Auskundschaftung der Tatorte und der Tagesabläufe der Opfer möglich waren. Es gibt kaum bis keine Hinweise darauf, dass das Kerntrio sich vor den Taten länger in den Städten aufgehalten hat. Demzufolge muss es Unterstützer*innen geben, die für das Kerntrio die Tatorte und Opfer beobachtet haben und Informationen geliefert haben. Diese Unterstützer*innen gilt es zu finden und ihre Rolle juristisch aufzuarbeiten. Dabei muss auch die Trio-These kritisch betrachtet werden. Bereits in den 1990er Jahren war das Kerntrio gut in der Neonazi-Szene vernetzt. Den Angeklagten im NSU-Prozess konnte Unterstützung bei der Beschaffung von Dokumenten, Wohnungen, Geld und Waffen nachgewiesen werden, die Unterstützung durch weitere Neonazis ist allerdings nicht vollständig aufgeklärt.
Laut dem NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag beläuft sich die Zahl der Helfer*innen und Helfershelfer*innen auf 129, wobei dies eine vorläufige Zahl ist. Dass hier weitere Ermittlungen, welche teilweise von der Staatsanwaltschaft auch schon aufgenommen wurden, notwendig sind, ist offensichtlich. Die Fortführung rechter Gewalt in Deutschland wie zuletzt in Chemnitz, Hanau, Halle und Kassel zeigt, dass rechte Netzwerke gefährlich sind und aufgedeckt werden müssen. Verbindungen zum NSU-Netzwerk sind hierbei nicht unwahrscheinlich, weshalb die lückenlose Aufklärung auch Prävention weiterer rechter Gewalt ist. So gibt es auch mögliche Verbindungen zwischen dem Mord an Halit Yozgat in Kassel am 6. April 2006 und dem Mord an Walter Lübcke 2018, ebenfalls in Kassel.
Zum Schluss stellt sich noch die Frage nach dem eklatanten und flächendeckenden Ermittlungsversagen sämtlicher Behörden. Der Beginn lag schon darin, dass 1998 bei der Durchsuchung der Garage des Kerntrios in Jena Böhnhardt von der Polizei gehen gelassen wurde und die nun gewarnten Neonazis untertauchen konnten. Die Ermittlungen der Mordfälle waren von starken institutionellen Rassismus geprägt. So wurde beispielsweise die rassistische Motivation hinter den Morden von der Polizei ausgeschlossen, obwohl Angehörige darauf hinwiesen. Stattdessen wurde von angeblichen Mafiageschäften und Drogenhandel geredet. Allein das Wording “SOKO Halbmond” oder “Dönermorde” zeigt, wie in deutschen Institutionen und Medien Rassismus reproduziert wurde und wird. Auch die Frage danach was der Verfassungsschutz wusste, ist offen. Aus der Aufklärung über die Fehler bei den Ermittlungen müssen Konsequenzen folgen.
Das Versprechen der lückenlosen Aufklärung muss endlich eingelöst werden. Darum ist es dringend notwendig weitere Ermittlungen zu führen und die Akten freizugeben. Auch die Frage, ob es weitere Taten des NSU gab, muss geklärt werden. Wir werden keinen Schlussstrich ziehen. Wir fordern Aufklärung und Konsequenzen!
Gedenken und Erinnerung
Wichtig ist es auch den Opfern und Betroffenen zu gedenken und die Erinnerung an sie aufrecht zu erhalten. Dabei stehen wir bedingungslos solidarisch an der Seite der Angehörigen. In den Städten, in denen die Morde begangen wurden, und in Jena gibt es schon regelmäßig Gedenkveranstaltungen für die Ermordeten. Auch einige Straßen wurden nach ihnen benannt. Diese meist lokalen Initiativen unterstützen wir. Es reicht jedoch nicht aus die Aufgabe des Gedenkens und der Erinnerung an einzelne Gruppen oder Einzelpersonen abzuwälzen. Es braucht eine eigene Erinnerungskultur für die Opfer rechter Gewalt, wozu auch eine Erinnerungskultur für die Opfer des NSU gehört. Diese Erinnerungskultur muss von Staat und Zivilgesellschaft unterstützt und gestaltet werden. Am wichtigsten ist dabei die Solidarität mit den Angehörigen und die Erinnerung an die Opfer. Jede weitere Forderung nach der Umbenennung von Straßen, Gedenkveranstaltungen und weiteren gedenk- und erinnerungskulturellen Anliegen sind darum zu unterstützen. Für das was geschah gibt es kein Vergeben und kein Vergessen.
Prozess
Der Prozess gegen Beate Zschäpe und André Eminger, Holger Gerlach, Ralf Wohlleben und Carsten Sch. begann am 6. Mai 2013 vor dem Oberlandesgericht (OLG) in München und endete nach fünf Verhandlungsjahren mit dem Urteil 2018. Das OLG verurteilte Beate Zschäpe als Mittäterin unter anderem wegen Mordes in zehn Fällen, versuchten Mordes in 23 Fällen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu lebenslanger Freiheitsstrafe und stellte die besondere schwere der Schuld fest. Doch dieser war durch die eingelegte Revision 2018 noch nicht rechtskräftig und auch wenn mit einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes nächstes Jahr gerechnet werden kann, wird relativ schnell klar, dass dies kein Schlussstrich sein darf.
Denn gleichzeitig werden Stimmen lauter, die auf fehlerhafte Herangehensweisen aus einer antifaschistischen und betroffenen Perspektive sichtbarer machen. Berechtigterweise steht der Einwand im Raum, dass der Fokus allein auf das Trio und ihr nächstes Umfeld den Netzwerkcharakter des Nationalsozialistischen Untergrundes nicht anerkennt. Dabei hat das Gericht die Chance verpasst, aufzuzeigen, dass der NSU ganz eng mit den militanten Nazi-Strukturen wie Blood and Honour, Kameradschaften und dem Thüringer Heimatschutz verbunden war. Die Aufklärung wurde sogar gezielt unterbunden, indem der Nebenklage nicht die komplette Akteneinsicht gewährt wurde und bei der Beweisaufnahme die ans Licht gebrachten Informationen zu den Verbindungen zu Blood and Honour aus dem Urteil herausgehalten wurden. Zudem wurde ebenfalls die Rolle der Nachrichtendienste und der Polizei im Urteil nicht beleuchtet. Ebenfalls wurde im Urteil rassistische Narrative aufgegriffen und all die Mordopfer des NSU werden in keinem Satz als individuelle Menschen aufgeführt, sondern vielmehr nur mit rassistischen stereotypen beschrieben. Weitere juristische Fehler versuchen die Anwält*innen der Nebenklage seit Jahren sichtbar zu machen, doch mit dem Urteil 2018 nahm das Gericht die Erfüllung ihrer Aufgabe an. Doch dabei sind immer die Ziele eines Strafverfahrens im Hinterkopf zu behalten. Der Sinn und Zweck des Strafverfahrens, dessen wesentlichen Punkte die Wahrheitsfindung, Rechtsstaatlichkeit und Rechtsfrieden sind, wurde im NSU-Prozess vor allem durch die Nebenklage forciert und dies – trotz – instabilen Rechtsposition der Nebenklage in einem Strafverfahren. Viele Punkte in dem Prozess haben nur durch den Nachdruck der Nebenklage an Bedeutung gewonnen. Deshalb muss es prozessual bedeuten, dass das Urteil niemals ein Schlussstrich sein kann und die Aufklärung auch über das Urteil hinaus weitergehen muss. Dabei ist von großer Bedeutung, dass sämtliche Akten zugänglich sein müssen!
Forderungen
- Wir fordern die Zerschlagung des NSU-Komplex! Um weitere Ermittlungsverfahren gegen Teile des Komplexes zu ermöglichen, fordern wir die Freigabe, der vom VS zurückgehalten Akten, der Gerichtsakten des OLG München, der Ermittlungsakten der Bundesanwaltschaft und die weitere Untersuchung in den 13 Untersuchungsausschüssen der Landtage und des Bundestages.
- Die Ermittlungsverfahren und der Prozess fußten viel zu lange auf rassistischen Stereotypen. Der Rassismus in den Ermittlungsbehörde hat das Täter*innennetzwerk geschützt. Wir fordern eine schonungslose Aufarbeitung in den Institutionen und ein Ende des Staatsrassismus.
- Das Urteil ist kein Schlussstrich! Wir wollen ein würdiges und öffentliches Gedenken an die Opfer der NSU-Morde und gesellschaftliche Solidarität mit den Angehörigen und von Rassismus Betroffenen. Die Stärkung der Erinnerungskultur ist dabei zivilgesellschaftliche und staatliche Aufgabe zugleich.
- Verfassungsschutz abschaffen! Nicht nur, dass der VS mit der zweifelhaften V-Personen-Praxis Neonazis und ihre Strukturen finanziell gestützt hat, der NSU hat auch deutlich gemacht, dass auch ein großes Netzwerk an Informant*innen schwere Straftaten nicht verhindern kann. Der Verfassungsschutz hat in Gänze versagt und die Verurteilung von Täter*innen durch seine Politik erschwert bis verhindert. Dieser Geheimdienst darf in dieser Form nicht fortbestehen.